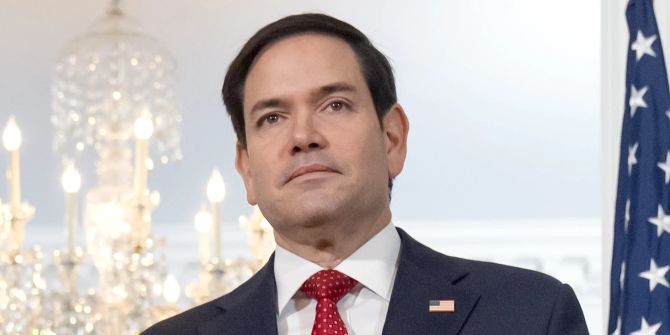Vorsicht, Zapfen!
Das für den Korkgeschmack im Wein verantwortliche Molekül kann nun eindeutig nachgewiesen werden: Mit dem neu entwickelten Sensor lässt sich der häufigste Weinfehler bereits in Spuren erkennen.

Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen beim Nachweis von Pestiziden oder auch Sprengstoffen. Dies zeigt eine soeben veröffentlichte Studie von Forschenden der Universität Freiburg mit Unterstützung der Universität Bordeaux.
Wenn ein Wein «Zapfen» hat, ist es meist der Korken, der entsprechende Moleküle freisetzt. Diese stammen oft von Fungiziden, mit denen die Korkeiche behandelt wurde. Mit Hilfe eines schwammartigen, porösen supramolekularen Netzwerks können diese Zapfenmoleküle «gefangen» werden. Sobald eine solche Substanz präsent ist und sich in der Pore des Sensors eingenistet hat, gibt es ein optisches Signal. Dies zeigt sich daran, dass der Sensor aufhört zu fluoreszieren (leuchten) und damit anzeigt, dass die Weinqualität beeinträchtigt ist.
Nachweis von Pestiziden oder Sprengstoff
Die Studie zeigt auch weitere Einsatzmöglichkeiten auf. Der Sensor funktioniert für bestimmte Pestizide oder Herbizide, die teilweise in manchen Ländern zugelassen, in der Schweiz aber verboten sind. So könnte man zum Beispiel Spuren davon in Obst und Gemüse nachweisen. Ferner reagiert die gitterähnliche Struktur auch auf Sprengstoffe und könnte dereinst auch zum Aufspüren explosiver Substanzen, z. B. am Flughafen, beitragen. Für die Tests kann die Sensorsubstanz entweder in Lösung benutzt werden (im Fall von Obstsaft oder ähnlichem) oder auf einem Papierteststreifen. Der Sensor lässt sich regenerieren und steht dann wieder für neue Messungen zur Verfügung.
Internationale Zusammenarbeit
Die wissenschaftliche Arbeit wurde soeben in der Zeitschrift «Inorganic Chemistry» (anorganische Chemie) veröffentlicht. Die Studie entstand unter der Leitung von Prof. Katharina M. Fromm und Diplomassistent Serhii Vasylevskyi vom Departement für Chemie der Universität Freiburg. Ein Teil der Tests wurden an der Universität Bordeaux, Frankreich durchgeführt unter der Aufsicht von Dr. Dario Bassani vom Institut für Molekularwissenschaften. Das Forschungsprojekt wurde zudem vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.