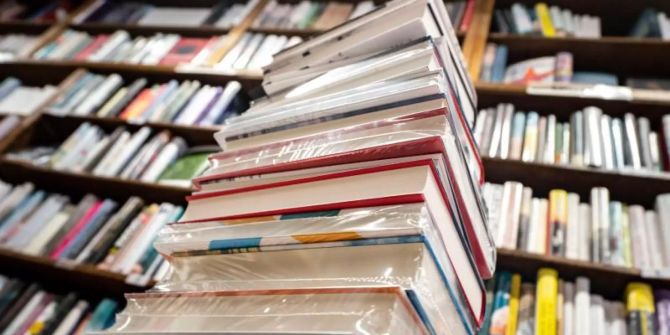RKI will Handydaten im Kampf gegen Corona-Pandemie nutzen
Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will das Robert-Koch-Institut (RKI) auch Auswertungen von Handydaten nutzen.

Das Wichtigste in Kürze
- Oberster EU-Datenschützer mahnt zur Vorsicht.
Von der Deutschen Telekom zur Verfügung gestellte Daten könnten zeigen, ob die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen habe, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Mittwoch in Berlin. Auch in Italien messen die Behörden so den Erfolg ihrer verordneten Massnahmen gegen die Pandemie. Der EU-Datenschutzbeauftragte rief zur Vorsicht bei der Verwendung von Telefondaten bei der Krisenbewältigung auf.
In Deutschland gelten seit dieser Woche massive Einschränkungen im öffentlichen Leben, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Schulen und Kitas, aber auch zahlreiche Geschäfte sind geschlossen. Die Bürger sind aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben. Allerdings ist umstritten, ob sich genügend Menschen daran halten.
Die Deutsche Telekom stellte dem RKI nun kostenlos Massendaten zur Verfügung, die Anhaltspunkte über Bewegungsströme liefern sollen. «Wenn wir sehen, dass die Menschen die Massnahmen gar nicht umsetzen, wissen wir, warum Infektionszahlen hoch bleiben», sagte RKI-Präsident Wieler. Das Institut wolle «faktenbasiert» Entscheidungen treffen.
In der italienischen Lombardei, der am schlimmsten von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus betroffenen Region in Europa, gehen die Behörden Medienberichten zufolge bereits so vor: Die Auswertung der Daten von Funkmasten der Telefonanbieter habe ergeben, dass nur 60 Prozent der Bevölkerung zu Hause bleibe, obwohl die Regierung eine strikte Ausgangssperre verhängt hat, berichtete die Tageszeitung «Il Corriere della Sera».
Die Nutzung persönlicher Daten könne nützlich und sinnvoll sein, «dieselben Daten können aber auch für sehr undemokratische Zwecke genutzt werden», warnte der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiorowski. Anonymisierte Handydaten seien zwar aus datenschutzrechtlicher Sicht kein Problem, «allerdings ist die vollständige Anonymisierung von Telefondaten technisch schwierig», sagte er der Nachrichtenagentur AFP.
Telekom und RKI versicherten, anhand der Daten seien keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer oder mit dem Coronavirus infizierte Menschen möglich. Das individuelle Tracking von einzelnen Mobilfunknutzern sei ausgeschlossen, stattdessen könnten statistische Vorhersagen zur Ausbreitung des Virus getroffen werden. Es handle sich um bundesweite Daten, die auf Bundesländer und auf Kreise oder Gemeinden heruntergerechnet werden könnten.
Die Telekom übergab nach eigenen Angaben am Dienstagabend eine Datenpaket im Umfang von fünf Gigabyte. Eine weitere Datenlieferung soll es in der kommenden Woche geben. Das Bundesgesundheitsministerium begrüsste dies. Es solle geprüft werden, ob die Massnahmen greifen, sagte ein Ministeriumssprecher.
Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz mahnte die Einhaltung des Datenschutzes an. «Werden die Grundprinzipien des Datenschutzes beachtet, gesetzliche Vorgaben eingehalten und die zuständigen Aufsichtsbehörden frühzeitig einbezogen, können auch auf diesem Wege datenschutzkonform wichtige Hinweise auf Ansteckungswege und Risiken gewonnen werden», sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
Auch in anderen Ländern wird auf Daten im Kampf gegen das Coronavirus gesetzt. So sind laut US-Medienberichten die Internetriesen Facebook und Google im Gespräch mit der US-Regierung über die Verwendung persönlicher Nutzerdaten. Eine mögliche Massnahme sei beispielsweise das Sammeln der Standortdaten der Smartphones von US-Bürgern und deren anonyme Verwendung, um dringende medizinische Notwendigkeiten vorhersagen zu können, berichtete die «Washington Post».
Eine weitergehende Nutzung von Daten, etwa zum Erstellen individueller Bewegungsprofile oder die Verknüpfung mit Gesundheitsdaten, ist für EU-Datenschützer Wiewiorowski grundsätzlich problematisch. Allerdings bietet das EU-Regelwerk auch diese Möglichkeit: Sowohl die Europäische Datenschutzgrundverordnung als auch die sogenannte E-Privacy-Richtlinie enthalten Klauseln für Ausnahmen zur Krisenbewältigung.
«Die Mitgliedstaaten können dafür entsprechende nationale Gesetze verabschieden», sagt Wiewiorowski. Grundsätzlich müsse aber immer klar formuliert sein, «wozu die Daten genutzt werden, wer Zugriff hat und wann die Nutzung ausläuft». Es könne sich immer nur um eine übergangsweise Lösung in Krisenzeiten handeln.