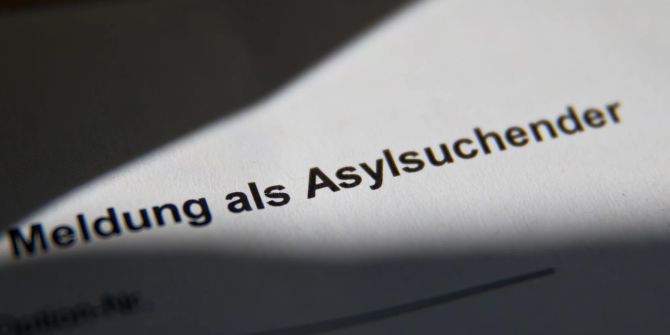Bundesregierung will Verteidigungsausgaben weiter erhöhen
Die Nato drängt Deutschland zu höheren Verteidigungsausgaben. Die Staatseinnahmen drohen allerdings in den nächsten Jahren deutlich geringer auszufallen als erwartet. Die Bundesregierung versucht die Zwickmühle nun mit einem ungedeckten Scheck zu lösen.

Das Wichtigste in Kürze
- Trotz eines Milliardenlochs in der mittelfristigen Finanzplanung hat Deutschland der Nato eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben zugesagt.
In ihrem jährlichen Strategiebericht verspricht die Bundesregierung den Bündnispartnern, es nicht bei den bereits versprochenen 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis 2024 zu belassen. Der dann innerhalb eines Jahrzehnts erreichte Anstieg von 80 Prozent werde «in den Jahren nach 2024 fortgesetzt», heisst es in dem Bericht, der bereits am Dienstag an die Nato-Zentrale in Brüssel übergeben wurde. Einen Nachweis, in welchen Schritten der Anstieg konkret erfolgen soll, bleibt die Bundesregierung der Nato aber schuldig.
Die neue Zusage soll offensichtlich vor allem US-Präsident Donald Trump besänftigen, der Deutschland seit vielen Monaten mit scharfen Attacken zu höheren Verteidigungsausgaben zu drängen versucht. Die Bundesregierung muss dabei allerdings hoffen, dass Trump wegen des bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampfes lieber die bis dato erfolgten Erhöhungen der Verteidigungsausgaben als seinen Erfolg feiert, als für neuen Streit zu sorgen - auch wenn die Erhöhungen deutlich geringer ausfallen als erwartet.
Ein Hinweis auf diese Strategie gab es bereits in der Nacht zum Mittwoch zu beobachten. Über Jahre seien die USA von Freunden «sehr unfair» behandelt worden, sagte der Republikaner in seiner Ansprache zur Lage der Nation. «Aber jetzt haben wir sichergestellt, dass Nato-Partner mehr als 100 Milliarden Dollar zusätzlich in Verteidigung investieren.»
Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gab öffentlich zunächst keine Bewertung der deutschen Pläne ab. Kurz vor der Abgabe des Papiers hatte er die Regierung in Berlin allerdings noch einmal ermahnt, den eingeschlagenen Weg der Erhöhung der Verteidigungsausgaben fortzusetzen. «Ich erwarte, dass alle Alliierten tun, wozu sie sich verpflichtet haben», sagte er der Funke-Mediengruppe.
In den sogenannten «Strategic Level Reports» legen die Nato-Staaten jedes Jahr ihre Beiträge zum Bündnis dar. Deutschland war diesmal das letzte der 29 Mitgliedsländer, das lieferte - mehr als einen Monat nach Ablauf der Abgabefrist am 31. Dezember 2018. Grund war ein hartes Ringen innerhalb der Bundesregierung, in der sie eine Zwickmühle aufzulösen versuchte.
Einerseits muss sie dem Drängen der USA, sich bei den Verteidigungsausgaben möglichst zügig auf das Nato-Ziel von zwei Prozent des BIP zuzubewegen, zumindest dem Anschein nach nachkommen. Andererseits sind die ganz fetten Jahre sprudelnder Steuereinnahmen in Deutschland vorbei. Seit Montag ist öffentlich bekannt, dass in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 ein Loch von 24,7 Milliarden Euro klafft.
Die Bundesregierung entschied sich so - anders als üblich - der Nato keine konkreten Schritte mehr für die Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu melden, sondern nur eine langfristige politische Zielsetzung: 1,5 Prozent des BIP bis 2024 und eine Fortsetzung der Erhöhung darüber hinaus. Gleichzeitig wird in dem Bericht darauf abgehoben, was Deutschland tatsächlich leistet: Zum Beispiel die Entsendung von 1200 Soldaten in den Nato-Einsatz in Afghanistan oder die Stationierung von 500 Soldaten für die Abschreckung Russlands in Litauen.
Nach Angaben aus Nato-Kreisen entspricht der deutsche Bericht allerdings nicht den Erwartungen. Denn sowohl in Brüssel als auch in Washington verlangt man eigentlich konkrete Angaben darüber, wie die Ziele bei den Verteidigungsausgaben erreicht werden können. So war bei Deutschland bis zuletzt völlig unklar, wie man 2024 auf eine Quote von 1,5 Prozent kommen soll, wenn man 2022 laut der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung nur bei 1,23 Prozent liegen wird.
Deswegen ist keineswegs sicher, ob der Bericht den Unmut der Amerikaner wirklich dämpfen kann. Bei einem Nato-Gipfeltreffen im vergangenen Sommer in Brüssel hatte Trump sogar einen Austritt der USA aus dem Bündnis nicht ausgeschlossen, sollten nicht alle Bündnispartner sofort zwei Prozent ihres BIP für Verteidigung ausgeben. Der US-Präsident beklagt seit Langem eine unfaire Lastenteilung im Militärbündnis und attackiert vor allem Deutschland wegen seiner vergleichsweise niedrigen Ausgabenquote von zuletzt nur 1,24 Prozent des BIP in 2018. Die USA lagen zuletzt bei einem Wert von 3,5 Prozent.
In der kommenden Woche treffen sich die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Auch bei der anschliessenden Münchner Sicherheitskonferenz werden die Militärausgaben Thema sein. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen lief sich am Dienstag bei ihrer Reise durchs Baltikum schon einmal für die anstehenden Auseinandersetzungen bei diesen Treffen warm. Die Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben verlaufe alles andere als langsam, verteidigte die CDU-Politikerin bei einer Diskussionsveranstaltung in der estnischen Hauptstadt Tallinn die deutsche Haltung. «Sie sollten nicht vergessen, wo wir herkommen.»
Sollten die 1,5 Prozent bis 2024 erreicht werden, bedeute das eine Steigerung von 80 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts, betonte von der Leyen. «Jeder kann das ja mal mit seinen eigenen Zahlen vergleichen.» Man sollte lieber über die tatsächlichen Beiträge einzelner Mitglieder zur Nato sprechen. Deutschland sei schliesslich der zweitgrösste Truppensteller in der Nato. «Wir stehen zum Zwei-Prozent-Ziel, ja. Aber wir sollten uns nicht nur auf das Zwei-Prozent-Ziel konzentrieren.» Stattdessen sollte es darum gehen: «Wer macht den Job?»