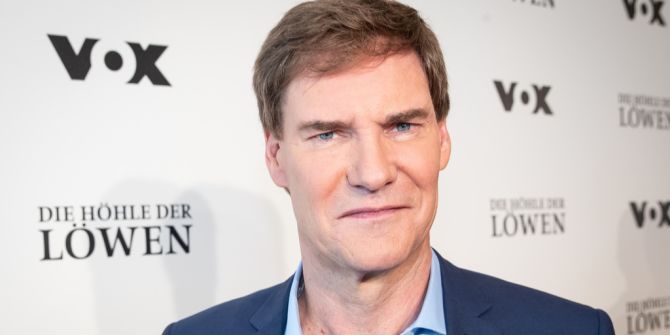So schön war die partielle Sonnenfinsternis
Am 29. März faszinierte eine partielle Sonnenfinsternis Millionen. Experten erklären die Naturphänomene und ihre Auswirkungen auf Wetter und Umwelt.

Die partielle Sonnenfinsternis am Samstag, 29. März 2025, bot ein beeindruckendes Schauspiel am Himmel. Der Mond verdeckte bis zu 93 Prozent der Sonne, je nach Standort.
Besonders in Grönland, Europa und Teilen Afrikas war das Ereignis sichtbar. Die grösste Verfinsterung wurde über Grönland erreicht, berichtet die «Rheinische Post».
Partielle Sonnenfinsternis: Wissenschaftliche Bedeutung
Neben der visuellen Faszination hatte die Sonnenfinsternis auch wissenschaftliche Bedeutung. Laut «Geo.de» beeinflusst der Mondschatten das Wetter erheblich: Der Erdboden kühlt ab, wodurch sich Wolken auflösen können.
Forscher der TU Delft bestätigten diesen Effekt durch Satellitendaten und Computermodelle. Die Abkühlung des Bodens während einer Sonnenfinsternis wirkt sich auf die Luftfeuchtigkeit aus.

«Wetter-Center.de» erklärt, dass kalte Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Diese Veränderungen sind besonders bei klarem Himmel deutlich spürbar.
Auch atmosphärische Schwerewellen können durch Sonnenfinsternisse ausgelöst werden, wie «Merkur.de» berichtet. Diese Wellen beeinflussen die Chemie der Atmosphäre und können Wolkenbildung begünstigen oder verhindern.
Bedeutung für zukünftige Forschung
Neben den direkten Auswirkungen werfen diese Beobachtungen Fragen zur Effektivität von Geoengineering auf, so «Geo.de». Verfahren zur künstlichen Abkühlung der Erde könnten durch veränderte Wolkenbildung beeinträchtigt werden.
Wolken reflektieren Sonnenlicht und tragen zur Kühlung bei – ihr Fehlen könnte den gewünschten Effekt mindern.
Wie «Rheinische Post» berichet, wir die nächste totale Sonnenfinsternis wird in Europa erst 2026 sichtbar sein. In Deutschland muss gar bis zum Jahre 2081 gewartet werden.
Solche Ereignisse bleiben seltene Gelegenheiten für Wissenschaft und Beobachtung gleichermassen.