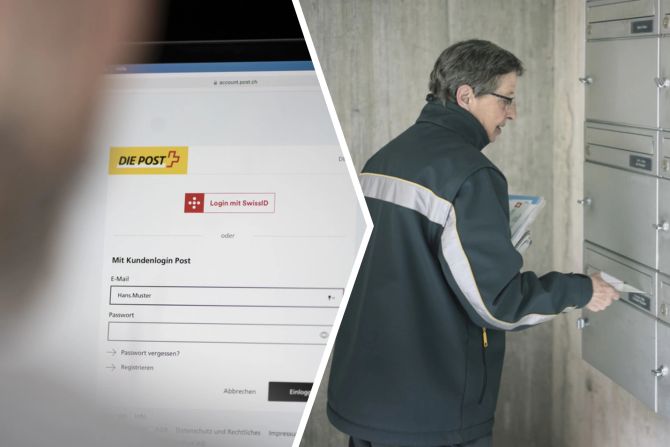Ursprung der Himmelsscheibe von Nebra in der Bronzezeit
Um die älteste konkrete Himmelsabbildung der Welt ist kürzlich ein Streit entbrannt. Forschende waren sich über das tatsächliche Alter der Scheibe uneinig.

Das Wichtigste in Kürze
- Die Himmelsscheibe von Nebra ist die älteste konkrete Himmelsabbildung der Welt.
- Im September zweifelten zwei Prähistoriker das Alter der Scheibe an.
- Ein deutsches Forschungsteam hat nun Klarheit geschaffen.
Um die eindrucksvolle Himmelsscheibe von Nebra ist kürzlich ein Streit über ihr Alter entbrannt. Ein deutsches Forschungsteam legt nun angebliche Beweise für die Entstehung der Scheibe in der Bronzezeit vor.
Zwei Forschende meldeten Zweifel am Alter der aus Metall gefertigten, ältesten konkreten Himmelsabbildung der Welt an.
Ein deutsches Forschungsteam um den österreichischen Wissenschaftler Ernst Pernicka trägt nun im Fachjournal «Archaeologia Austriaca» der ÖAW Belege zusammen. Ihnen zufolge ist die Himmelsscheibe von Nebra in der Bronzezeit entstanden.
Der am besten untersuchte archäologische Gegenstand
Die Himmelsscheibe wurde im Sommer 1999 von zwei Raubgräbern auf dem Mittelberg bei Nebra in Deutschland entdeckt. Sie befand sich in einem Ensemble an Funden (Hort) aus der frühen Bronzezeit, also der Zeit um 1600 vor Christus. Neben der berühmten Darstellung aus Bronze und Gold wurden auch zwei Schwerter, zwei Beile, zwei Armspiralen und ein Meissel gefunden. Erst 2002 konnte dieser Schatz bei einer fingierten Verkaufsaktion in Basel sichergestellt werden.

Die im Durchmesser rund 32 Zentimeter grosse Scheibe gehöre vermutlich zu den am besten untersuchten archäologischen Gegenständen. Dies hiess es am Freitag in einer Aussendung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Deren Institut für Orientalische und Europäische Archäologie gibt die Fachzeitschrift «Archaeologia Austriaca» heraus.
Streit um das Alter der Himmelsscheibe
Rupert Gebhard und Rüdiger Krause haben nach eigenen Angaben erneut Daten zur Rekonstruktion von Fundort und Begleitumständen analysiert. Anfang September erklärten sie, dass sie die Scheibe für echt, aber 1000 Jahre jünger als bisher angenommen, hielten. Gebhard ist der Direktor der Archäologischen Staatssammlung München und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität. Krause ist Professor für Vor- und Frühgeschichte Europas an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Die 13-köpfige Forschungsgruppe um Studien-Erstautor Pernicka erklärt nun: Gebhard und Krause haben «mit unvollständigen und teilweise falschen oder verfälschend wiedergegebenen Daten» argumentiert. Demnach sei ohne Zweifel gesichert, dass es sich beim Mittelberg bei Nebra auch um den tatsächlichen Fundort handelt. Das dokumentierten auch aktenkundige Aussagen der Raubgräber und eines Hehlers.
Kein Zweifel besteht für die Forschergruppe daran, dass die Scheibe mehrmals umgestaltet und lange verwendet wurde. Man könne aber detailliert zeigen, dass sie am Ende der frühen Bronzezeit vergraben wurde. Daher habe sie zum Beginn der Eisenzeit schon lange im Boden gelegen.