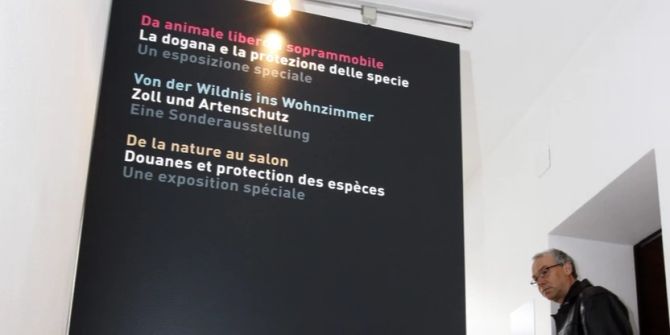«Charlie Hebdo» bedroht: Stationäre Massnahme für Mann aus Syrien
Das Bundesstrafgericht hat gegen einen in der Schweiz lebenden Syrer stationäre Massnahmen verhängt. Bei den Taten war der psychisch kranke Mann schuldunfähig.

Das Bundesstrafgericht hat für den in der Schweiz lebenden Syrer, der die Redaktion von «Charlie Hebdo» bedroht hatte, eine stationäre Massnahme verhängt. Zudem wird der Mann nach einer allfälligen Entlassung für fünf Jahre des Landes verwiesen. Dem 30-Jährigen wurde eine schwere psychische Störung sowie eine Schuldunfähigkeit attestiert.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte im Zustand der Schuldunfähigkeit den Tatbestand der versuchten Nötigung erfüllte. Laut psychiatrischem Gutachten sei der 30-Jährige zu den Tatzeitpunkten schuldunfähig gewesen, begründete die vorsitzende Richterin den Entscheid. Der Mann leide an einer schweren chronischen paranoiden Schizophrenie.
Hohe Wiederholungsgefahr
Aufgrund der Schwere der Erkrankung sei das Risiko weiterer Straftaten gross. Aus diesem Grund brauche es eine stationäre Massnahme in einer geschlossenen Anstalt, erklärte die Richterin. Die Anordnung sei auch im Interesse des Beschuldigten selbst.
Es gebe keinerlei Anzeichen, dass sich der Beschuldigte in die schweizerische Gesellschaft integrieren möchte oder dies versucht habe, sagte sie weiter. Aufgrund seines «Glaubensfanatismus» habe er Lehr- und Arbeitsstellen verloren und von der Sozialhilfe gelebt.
Der Mann selbst habe immer wieder den Wunsch geäussert, in ein muslimisches Land auszureisen. Dies bezeuge die Tatsache, dass er nicht in der Schweiz verbleiben wolle. Selbst nach einer allfällig erfolgreichen Therapie bleibe das Risiko einer erneuten Straftat hoch, sagte die Richterin. Das öffentliche Interesse an einer Landesverweisung sei daher höher einzustufen als das Interesse des Beschuldigten, in der Schweiz zu bleiben.
Beschuldigter ist schwer krank
Im vorliegenden Fall liege keine Anklage «im klassischen Sinne» vor, sagte der Staatsanwalt des Bundes in seinem Plädoyer. Es gehe um einen Mann, der in erster Linie dringend einer psychiatrischer Behandlung bedürfe. Darin seien sich alle einige gewesen, auch der Beschuldigte selbst, der einen Antrag auf vorzeitigen Massnahmenvollzug gestellt habe.
Die vorsitzende Richterin bat vor den Plädoyers beide Parteien, auch zur Frage eines allfälligen Landesverweises Stellung zu nehmen. Der Mann sei für die Öffentlichkeit eine «reale Bedrohung», sagte dazu der Staatsanwalt des Bundes.
Wiederholte Bewaffnung
Es bestehe ein «erhöhtes öffentliches Interesse, dass der Beschuldigte des Landes verwiesen wird, sollte er dereinst aus der Massnahme entlassen werden». Der Mann sei immer wieder durch Gewaltandrohung aufgefallen. Zudem habe er sich wiederholt bewaffnet.
Das Delikt sei nicht von «sehr grosser Schwere», fuhr der Staatsanwalt fort. Es müsse aber möglich sein, auch schuldunfähige Personen des Landes zu verweisen. Die Bundesanwaltschaft hatte daher eine stationäre therapeutische Massnahme sowie einen fakultativen Landesverweis von zehn Jahren gefordert. Die Privatklägerschaft – der Verlag von «Charlie Hebdo» – war am Prozess nicht zugegen.
Landesverweis nicht möglich?
Der Beschuldigte leide seit seiner Kindheit an einer psychischen Krankheit, erklärte der Verteidiger vor Gericht. Die Taten des Mannes seien deshalb «einzig und allein im Lichte seines psychischen Zustandes» zu bewerten, auch wenn objektiv eine versuchte Nötigung vorliege.
Der 30-Jährige habe seit 2013 den Status eines vorläufig aufgenommenen Flüchtlings, was gegen einen fakultativen Landesverweis spreche. Zudem könne er auch nicht in sein Heimatland zurück, da er sich aufgrund seiner Krankheit nicht zurechtfinden würde. Ausserdem lebe seine Familie in der Schweiz.
Beschuldigter verweigerte Kooperation
Zu Beginn des Prozesses hatte der Beschuldigte einen Übersetzer abgelehnt. Er begründete seinen Entscheid damit, dass der Übersetzer nicht sagen wollte, ob er gläubiger Muslim sei.
Der Beschuldigte störte wiederholt die Verhandlung. So fiel er sowohl dem Staatsanwalt als auch seinem Verteidiger ins Wort und gab zeitweise keine Antwort auf Fragen. Als es an ihm war, das sogenannt «letzte Wort» in der Verhandlung auszusprechen, sagte er: «Dieses Gericht ist unfähig.»