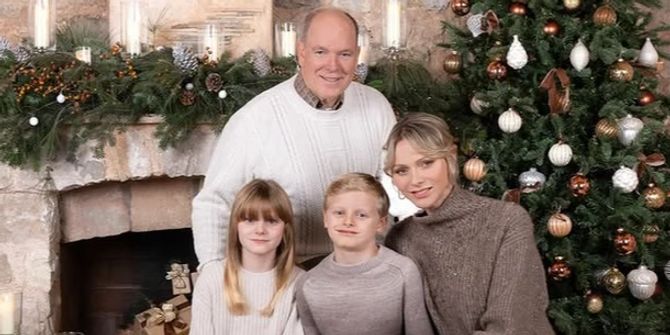Weniger Zwillinge nach künstlicher Befruchtung
Mehrlingsgeburten nach künstlicher Befruchtung sind in den letzten zwanzig Jahren drastisch gesunken.

Mehrlingsgeburten nach künstlicher Befruchtung sind in den letzten zwanzig Jahren stark zurückgegangen. Die Zahlen schrumpften von 17,4 Prozent im Jahr 2002 auf 2,8 Prozent im Jahr 2023, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag bekanntgab.
Dieser Rückgang lässt sich grösstenteils durch das Inkrafttreten der Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes im Jahr 2017 erklären. Es erlaubt eine höhere Anzahl Embryonen (maximal zwölf) aufzubewahren, wie Tonia Rihs von der Sektion Reproduktionsstatistik des BFS auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte.
Die medizinische Praxis könne so besser bestimmen, welche Embryonen bei der künstlichen Befruchtung (im Fachjargon In-vitro-Fertilisation, kurz IVF) eingesetzt werden können. Zudem hätten Transfers eines einzelnen Embryos stark zugenommen, fügte sie hinzu.
Gesetzliche Änderungen beeinflussen die Praxis
2017 wurden bei 4085 Transfers zwei Embryonen eingesetzt. Nur ein Embyro wurde in 3789 Fällen transferiert. 2023 betraf die Mehrheit der Transfers nur einen Embryo (7341). Zwei Embryonen wurden nur noch 811 Mal eingesetzt.
2023 liessen sich 6513 Paare mit der IVF-Methode behandeln. Die Zahl ging damit um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Als Folge davon wurden 2511 Kinder lebend geboren. Das entspricht hingegen einem Anstieg um 5,9 Prozent gegenüber 2022.
Diese 2511 Kinder machen drei Prozent aller Geburten in der Schweiz aus. 67 Kinder davon wurden nach einer Samenspende geboren. Dennoch führten nur rund 30 Prozent aller Embryotransfers zu einer Geburt. Aber auch das ist ein Anstieg. 2017 lag dieser Wert noch bei 23 Prozent, 2022 bei 27,6.