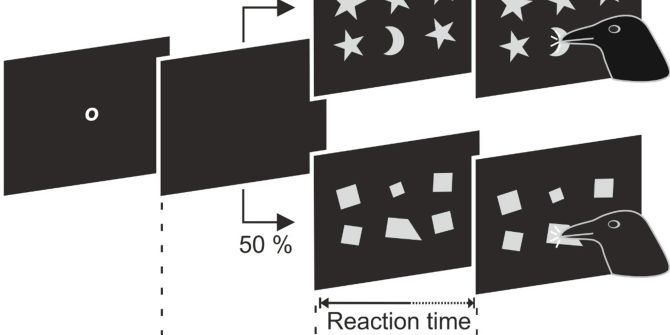Bob Odenkirk ist «Nobody»: Wann ist ein Mann ein Mann?
Diese Frage beantwortet «Hardcore»-Regisseur Naishuller in diesem US-Stück auf politisch unkorrekte, durchaus erfrischende Manier. «Better Call Saul»-Fans kommen eh kaum um den Film herum.

Das Wichtigste in Kürze
- Das amerikanische Kino liebt Nobodys.
Dutzendmenschen und Nullen. Die allerdings irgendwann freilich über sich hinauswachsen. Man denke an Forrest Gump: unterdurchschnittlich klug. Kaum attraktiv. Aber was die legendäre Figur im gleichnamigen Film von 1994 nicht alles erreicht!
Dieser Film nun, der trägt den «Niemand» nicht nur gleich ganz bescheiden im Titel: Auch dieser Nobody hat es in sich - selbst wenn die ersten Minuten überhaupt nicht darauf hindeuten. Gespielt wird «Nobody» vom Amerikaner Bob Odenkirk - einem Darsteller, den vor allem Fans der Serien «Breaking Bad» und «Better Call Saul» fest in ihr Herz geschlossen haben.
Alle trampeln auf ihm herum
Die ersten Szenen also, die zeigen unseren Nobody unter anderem dabei, wie er zum wiederholten Male von seiner Frau niedergemacht wird. Wie ihm zum zigsten Mal die höhnisch hupende Müllabfuhr vor der Nase wegbrummt. Wie Nobody ein jämmerliches Bild dabei abgibt, als er ausgerechnet am Buswartehäuschen Klimmzüge macht.
Nein, so rufen uns diese ersten, durchaus mit Selbstironie behauchten Bilder zu: Dieser mittelalte Mann, der hat es nicht leicht. So eine Midlife-Crisis (Odenkirk passt mit seinen bald 60 Jahren noch grad so in diese Symptom-Schublade), die will erst mal geschultert sein.
Und wir wären hier nicht im amerikanischen Mainstream, wenn nicht alles noch viel schlimmer käme: Die nächste Demütigung, die wartet nämlich schon am folgenden Abend auf Mr. Nobody (eigentlich: Hutch Mansell). Zwei Einbrecher dringen in Nobodys Haus ein; nicht sonderlich gefährlich aussehend. Dem weiblichen Teil des Diebesduos, dem könnte Hutch mit seinem Golfschläger eins überbraten. Nobody aber versagt.
Die Wut platzt aus ihm heraus
«Die hättest du packen können, Dad», muss sich Hutch nach dem Einbruch denn auch von seinem Sohn vorhalten lassen. Vom Spott, der ihn am nächsten Morgen an seinem Arbeitsplatz erwartet, ganz zu schweigen. Nobody aber, das kommt jetzt sukzessive raus, der hat mal zwölf Jahre lang «für sehr gefährliche Leute» gearbeitet. Und er wird sich nun, nach all den Demütigungen, doch noch dementsprechend (also sehr blutig und gewaltvoll) rächen.
Politisch korrekt ist dieser Film von Regisseur Ilya Naishuller nicht. «In mir schlummert schon lange etwas, das unbedingt raus will», heisst es an einer Stelle. Unterdrückte Männlichkeit, Kerle, die es nicht mehr aushalten: Das ist nicht neu, man kennt diverse Film-Männer, bei denen unerwartet alle Sicherungen rausfliegen.
Aus David Cronenbergs «A History of Violence», aus dem kultigen, fast in Vergessenheit geratenen «Falling Down» (mit Michael Douglas). Auch an Keanu Reeves «John Wick» (dessen Produzent David Leitch auch an «Nobody» beteiligt war) kann man denken. Genauso wie an Walter White, den ach so durchschnittlichen Chemielehrer aus «Breaking Bad», der schliesslich als Drogen-Gangster über sich hinauswächst.
So comichaft wie bei Quentin Tarantino ist die Gewalt hier nicht. Und: Nobody kein Unsympath. Er hat mehr Stil und Feingefühl, als dies sein, doch ziemlich überzogener Gewaltausbruch suggeriert.
Besonders schön: die finalen Momente des 90-Minüters. Da spielt plötzlich Nobodys beachtliche Vinylschallplattensammlung eine Rolle. Ein Film, der Pat Benatar, Tschaikowsky und Nina Simone im Kinosaal versammelt, kann nicht ganz schlecht sein. Regisseur Naishuller ist selbst Mitglied einer Rockcombo.
Den Vorwurf aber, hier werde einer unreflektierten, veralteten Form von Männlichkeit gehuldigt - während ernst zu nehmende Frauenfiguren kaum eine Rolle spielen -, diesen Vorwurf muss sich ein Film derartigen Zuschnitts im Sommer 2021 durchaus gefallen lassen.
Nobody, USA/Japan 2021, 92 Min., FSK ab 16, von Ilya Naishuller, mit Bob Odenkirk, Christopher Lloyd, Connie Nielsen