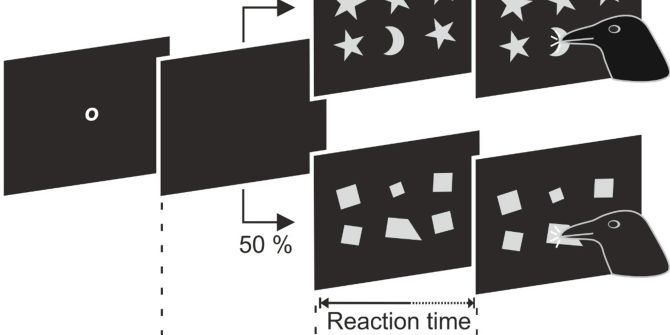Wie Museen mit Diskriminierung umgehen
Wie umgehen mit diskriminierenden Begriffen und Darstellungen? Diese Frage treibt auch Museen in Deutschland um. Die Häuser finden ganz unterschiedliche Antworten. Auch eine Ente ist davon betroffen.

Das Wichtigste in Kürze
- In auffallendem Orange umfasst der Rahmen die Keramikfigur «Der Zollgardist und der Jude».
Das ist nicht zu übersehen.
Und genau das ist die Absicht des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe gewesen: Denn der auf dem Orange gedruckte Text soll auf ein wichtiges Thema hinweisen: Antisemitismus. Die Figur stelle Menschen jüdischen Glaubens stereotyp und abwertend dar und zeige ein verbreitetes judenfeindliches Weltbild des 18. und 19. Jahrhunderts.
Die Debatte um Diskriminierung und diskriminierende Sprache hat längst auch Museen erreicht. So handelt es sich in Karlsruhe um keine spezielle Schau über Antisemitismus. Vielmehr ist das Museum bei sechs Objekten der Sammlungsausstellung «Baden und Europa» eingeschritten, hat sie markiert und um erläuternde Texte ergänzt.
Diese «Interventionen» betreffen etwa ein koloniales Plakat, eine Werbe-Postkarte aus einem Heim für Menschen mit Behinderung und die «Schwarzwaldklinik». Hier geht es um Sexismus, die Fernsehserie habe tradierte Rollenbilder fortgeschrieben: «So zum Beispiel in Folge 61: Dr. Christa Brinkmann wird vorgeworfen, dass ihr Sohn krank sei, weil sie berufstätig ist und sich nicht ausreichen um ihn kümmert.»
Seit Entstehung der Werke hätten sich Werte- und Moralvorstellungen geändert, sagt der Präsident des Deutschen Museumsbunds, Eckart Köhne, der auch Chef des Badischen Landesmuseums ist. «Bestimmte Begriffe möchte man heute nicht mehr verwenden.»
Da fällt wohl den meisten sofort das sogenannte N-Wort ein, mit dem eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben wird. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden etwa haben bei weit über hundert Kunstwerken Titel geändert, weil die historische Namensgebung diskriminierend oder rassistisch war. Der AfD-Abgeordneten Thomas Kirste sprach von «linker Bilderstürmerei».
Auch das Kunstmuseum Moritzburg in Halle tilgte das «N-Wort». Werke heissen nun «Männlicher Studienkopf» oder «Smith from Halifax». Das Museum Brandhorst in München hat zum Beispiel bei Andy Warhols Arbeit «Mustard Race Riot» von 1963 die im deutschen lange übliche Übersetzung von «Race Riot» mit «Rassenunruhe» ersetzt durch «Proteste gegen Rassismus senffarben». Dieser Titel sei inhaltlich und historisch präziser, «Rassenunruhe» sei negativ konnotiert.
Oberstes Ziel sollte aus Sicht von Museumsbund-Präsident Köhne jedoch nicht sein, Titel einfach nur zu ändern. «Wichtiger ist die Einordnung.» Aufgabe der Häuser sei, die differenzierte Sicht auf die Dinge zu vermitteln. «Das muss man lernen, das kann man keinem ersparen.» Heutzutage könnten Betrachter die Werke Rubens' wegen der Nacktheit vielleicht anstössig finden. Damals sei das aber keineswegs so gewesen oder als Provokation gedacht. «Das muss man erklären.»
Köhne hält auch wenig davon, umstrittene Werke ganz verschwinden zu lassen, wie es 2018 eine Kunstgalerie in Manchester mit dem Gemälde «Hylas and the Nymphs» wegen einer umstrittenen Darstellung von Frauen darin machte - und es abhängte. «Man kann einen Teil der Kulturgeschichte eines Landes nicht einfach aussortieren», sagt Köhne. Der Kontext müsse berücksichtigt werden. «Man kann ein Denkmal immer stürzen, aber damit beseitigt man nicht das Problem.»
Im Berliner Brücke-Museum lässt sich noch bis 20. März ein anderer Ansatz in der Ausstellung «Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext» sehen: In Wandtexten werden schwierige Begriffe wie «Entartete Kunst» auf den Kopf gestellt, was zum Nachdenken anregen soll. Auch der Titel von Emil Noldes Gemälde «Neu-Guinea-Wilde» aus dem Jahr 1915 ist nur verkehrt herum zu lesen.
Der heutige Blick auf die kolonialen Kontexte muss aus Sicht von Museumsdirektorin Lisa Marei Schmidt nicht die Wertschätzung für die Arbeiten minimieren: «Das sind wunderbare Werke.» Es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen, nicht die Künstler schuldig zu machen.
Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler verweist darauf, dass bei zeitgenössischer Kunst die Werktitel in der Regel nicht verändert würden. Das wäre auch befremdlich, erklärten die Bundesvorsitzenden Dagmar Schmidt und Marcel Noack. Zumal sich das Urheberrecht auch auf die zum Bild gehörenden Titel erstrecke.
Die Frage bei Diskussionen um aktuelle Werke sei, ob dahinter ein kalkulierter oder hingenommener Skandal des Urhebers oder der Urheberin stecke. «Ob hierbei Diskriminierung billigend in Kauf genommen wird, Grenzen überschritten oder Mittel verwendet werden, die notwendig für die künstlerische Aussage sind, lässt sich nur an konkreten Beispielen festmachen und nicht pauschal beantworten.»
Im Unterschied dazu seien Werktitel wie in Dresden «aus heutiger Sicht definitiv als diskriminierend einzustufen und sollten dem heutigen Sprachgebrauch nach angepasst werden», schreiben Schmidt und Noack. Gerade für die Rezeptionsgeschichte von Kunst und Gesellschaft sollten diese Umbenennungen transparent kommuniziert werden - wie es die Staatlichen Kunstsammlungen in ihrer Datenbank machen. Eine Kontextualisierung - sowohl im Sprachgebrauch als auch der Motive - erlaube es nachfolgenden Generationen hoffentlich, Werke einzuordnen.
Wie weitreichend die Debatte um diskriminierende Sprache reicht, zeigt ein Blick in die Naturkundemuseen: Auch sie sind betroffen. So wurde 2020 eine Liste der deutschen Vogelnamen veröffentlicht, in der diskriminierende, kolonialistische und rassistische Bezeichnungen ersetzt worden sind, wie Albrecht Manegold vom Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe berichtet. Dort wird nun die Pünktchenente aus Afrika aufgeführt. Ihr lateinischer Name Spatula hottentota weist noch auf die früher gebräuchliche Bezeichnung «Hottentottenente» hin.
«Auch für andere Tiergruppen gibt es entsprechende Listen», erklärt Manegold. Das Museum passe die Bezeichnungen in der eigenen Datenbank an. Und auch das Publikum erfährt davon: «In Ausstellungstexten sollten nur die aktuell gebräuchlichen Namen Verwendung finden.»
Ausstellung «Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext», Brücke-Museum, (18.12.-20.3.), Mi-Mo, 11–17, 8 Euro