Coronavirus: Regel mit 300er-Zonen stellt Clubs vor Schwierigkeiten
Für Schweizer Clubs und Bars ist seit Montag Schluss mit der Sperrstunde. Das freut sie einerseits. Andererseits kämpfen sie mit der Hürde der 300er-Zonen.

Das Wichtigste in Kürze
- Die Sperrstunde fällt weg. 1000 Personen dürften nun aufs Mal in einen Club.
- Trotzdem kämpft das Schweizer Nachtleben weiterhin ums Überleben.
- Club-Kommissionen erklären die Problematik der geforderten 300er-Zonen.
Am Freitag verkündete der Bundesrat, dass Clubs und Bars wieder mehr Gäste empfangen dürfen. Nicht nur 300 aufs Mal wie bisher, sondern 1000 Personen dürfen seit Montag theoretisch gleichzeitig das Tanzbein schwingen.
Auch die Polizeistunde ist seit gestern Geschichte. Dies erweckt den Eindruck, dass sich das Schweizer Nachtleben wieder in Richtung Normalität bewegen kann. Trotz Coronavirus.
Trotz Coronavirus wieder mehr als 300 Gäste
Doch die Lockerungen bringen für die Clubs auch eine grosse Schwierigkeit mit sich. Denn die 1000 Personen müssen in 300er-Zonen aufgeteilt werden können. Gemäss Max Reichen, Geschäftsführer der Bar- und Clubkommission Bern (BuCK), der grosse Haken an der neuen Regelung.
«Die neue Lockerung, dass bis zu 1000 Personen an eine Veranstaltung dürfen - die gilt für Clubs eigentlich nicht. Fast kein Club hat den Platz um 1000 Leute in kleinere Gruppen aufzuteile. Und sich noch darauf zu achten, dass sich die einzelnen Gruppen nicht in die Quere kommen.»

Mit der neuen 300er-Zonen-Regel müssten in einem Club drei unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden können, führt Reichen die Problematik weiter aus. Dies sei für den Grossteil der Clubs einfach schlicht unmöglich.
Und nicht nur das: Es können nicht einfach neue Personen in den Club rein, wenn eine andere diesen verlässt. Denn es dürfen erst neue Partygänger die Tanzfläche betreten, wenn alle vorherigen gegangen sind, so Reichen.
Alexander Bücheli, Sprecher der Clubkommission Zürich. sieht noch ein weitere Schwierigkeiten: «Das Problem dabei sind auch die gemeinsam genutzten Räumlichkeiten wie Toiletten, Garderobe und der Eingangsbereich.» Auch sei es schwer vorstellbar, dass sich die Tänzer eine Nacht lang für einen Sektor entscheiden wollen.

«Mit der 1000er-Regel erhalten wir auf Papier eine gewisse Perspektive, die sich aber nur schwer in der Realität umsetzen lässt. Leider einmal mehr ein Beispiel dafür, dass keine Rücksicht auf die Realität der Veranstaltungsbranche genommen wurde!», klagt er.
Finanziell geht es langsam wieder bergauf
Max Reichen sieht dennoch einen Hoffnungsschimmer: «Mit der Aufhebung der Sperrstunde und den Lockerungen geht es für Bars und Clubs langsam aber sicher finanziell wieder bergauf.»
Doch es gäbe noch weitere Faktoren, welche die Finanzen der Clubs negativ beeinflussen könnten. «Ein weiteres Problem bilden die internationalen Acts. Durch die unterschiedlichen Restriktionen aufgrund des Coronavirus ist es diesen gar nicht möglich, auf Tournee zu gehen.»
Ähnliches beobachtet auch die Clubkommission Zürich: «Alleine mit Schweizer Künstlern lässt sich die Nachfrage nicht decken.» Dies schreibt die Kommission in einer Medienmitteilung.
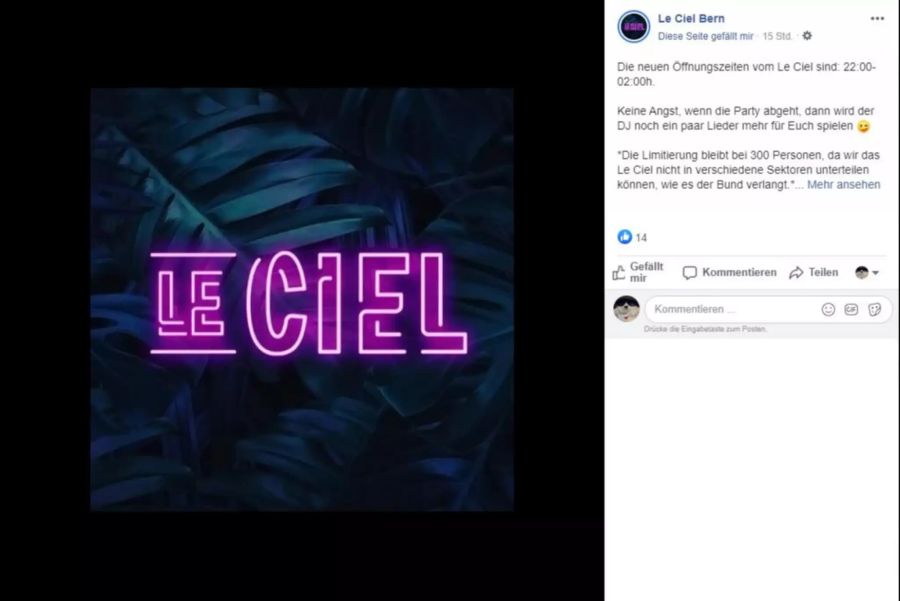
Sorgen bereitet den Clubs auch eine möglich zweite Welle. Sei seien wohl die ersten, die dann wieder schliessen müssten. «Aber für das Buchen von Acts brauchen wir eine gewisse Sicherhei», so Max Reichen.
«First out, last in», doppelt Bücheli nach. Der Umsatz bewege sich seit dem Lockdown gegen null. Das Coronavirus und dessen Nachwehen würden im Nachtleben noch lange zu spüren sein, auch finanziell.
Clubkommissionen empfanden Sperrstunde als überflüssig
Das die Sperrstunde wegfalle, sei aber eine grosse Erleichterung, sagt Max Reichen. Dies auch deswegen, weil sich jetzt nach Mitternacht nicht mehr alle unkontrolliert auf der Strasse treffen würden.

Auch Bücheli sah keinen Sinn in der Polizeistunde: «Die Polizeistunde war auch kontraproduktiv, da Bars und Clubs euphorisierte Gäste vor die Tür stellen mussten. Dort wurde einfach weitergefeiert, ohne Schutzkonzept und Rückverfolgbarkeit.»
Angesichts der neuen 300er-Zonen-Regen stört Max Reichen vor allem «die fehlende Kommunikation zwischen den Kommissionen und dem Bund.» Man hätte von gegenseitigem Wissen und Erfahrung profitieren können, um eine bessere Lösung zu finden. «Wir hätten mit dem Bund über das Thema sprechen können, wurden jedoch nicht zurate gezogen.»












