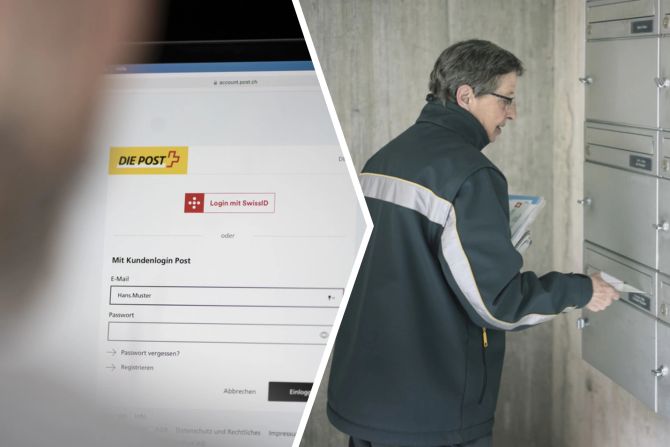Icefall-Doctors: Ohne sie geht nichts am Mount Everest
Eine grosse Menge riesiger Eisblöcke, die sich langsam, aber stetig in Richtung Tal bewegen: Der Khumbu-Eisbruch ist eine riskante Passage am Mount Everest.

Der Khumbu-Eisbruch ist eine der gefährlichsten Passagen auf dem Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Es ist eine grosse Menge riesiger Eisblöcke, die sich langsam, aber stetig in Richtung Tal bewegen, und die Bergsteigerinnen und Bergsteiger bei ihrem Marsch nach oben überwinden müssen. Die meisten von ihnen schaffen dies nur, weil zuvor einheimische Spezialisten eine möglichst sichere Route gefunden und diese mit vielen Leitern und Seilen passierbar gemacht haben – ein Netzwerk, das sie während der derzeitigen Everest-Hauptsaison über Monate immer wieder anpassen müssen.
Bergführer Ngima Gyalzen Sherpa war vor zwei Jahren Teil dieses Teams. Und ihn habe damals besonders seine Berufsbezeichnung fasziniert, wie er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagt: «Icefall-Doctor».
«Erfahrene Icefall-Doctors können die Stärke und Einsturzgefahr von Eis bestimmen, indem sie es nur anschauen», sagt der heute 26-jährige Nepalese. «Das können sie genauso gut, wie eine Mutter sagen kann, was mit ihrem Kind nicht stimmt, wenn sie es sieht.» Um das Eis zu analysieren, bräuchten die Experten aber Tageslicht und das könne gefährlich werden, sagt Sherpa. Denn sobald die Sonne auf das unstete Gebilde brenne, werde es fragiler.
Zwischen den Klötzen können sich tiefe Spalten auftun, und immer wieder brechen Stücke ab und stürzen nach unten. Deshalb machten sich die meisten Abenteurer-Gruppen mit Stirnlampen mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden auf, um den Khumbu-Eisbruch zwischen dem Basis- und dem ersten von vier Höhenlagern zu passieren.
Rund 50 Menschen beim Khumbu-Eisbruch gestorben
Einige Icefall-Doctors haben bei ihrer Arbeit ihr Leben verloren. Wie viele es genau sind, ist nicht bekannt. Aber laut dem Expeditionsarchiv «Himalayan Database» starben insgesamt rund 50 Menschen beim Khumbu-Eisbruch – etwa weil sie von Lawinen begraben wurden oder in tiefe Kluften fielen. Das entspricht etwa jedem vierten Todesfall auf der nepalesischen Seite des Mount Everests. Der Berg kann auch von China bestiegen werden, was aber seltener passiert.
Ngima Gyalzen Sherpa sagt, auch er sei bei seinem Einsatz als Icefall-Doctor in eine tiefe Spalte gefallen: «Beim Fall glaubte ich, ich würde sterben und dachte an meine Mama.» Seine Mutter, Ang Dami Sherpa, habe ihn zunächst überhaupt erst zu einer Karriere in der Bergsteigerei inspiriert. Sie hat sich als Läuferin bei Bergmarathons, die wegen der grossen Höhe besonders anstrengend für den Körper sind, einen Namen gemacht.
Begeistert habe ihn damals auch, dass aus seinem Dorf Bergführerstars wie Kami Rita Sherpa entstammten, der einen Weltrekord für die meisten Besteigungen des Mount Everests hält – insgesamt 28 Mal stand er auf der 8849 Meter hohen Spitze. «Jedes Jahr werden sie nach ihrer Rückkehr von den Bergen gefeiert», sagt Ngima Gyalzen Sherpa. Das habe er auch für sich gewollt.
Sherpa: Bergsteigen ist immer gefährlich
Nach dem Fall in die Spalte habe er sich schliesslich mit Werkzeugen und der Hilfe seiner Kollegen aus der Tiefe befreien können. Seither habe er nicht mehr als Icefall-Doctor gearbeitet – aber nicht der Gefahr wegen, wie er sagt. Mit seiner Arbeit als Bergführer von ausländischen Gästen verdiene er schlicht mehr. Zahlen wollte er nicht nennen.
Icefall-Doctors erhielten nicht genügend Wertschätzung, konstatiert ein anderer nepalesischer Bergführer und -retter, Narendra Shahi Thakuri. «Der Eisbruch ist die technisch schwierigste Passage beim Everest und nicht alle wollen ein solch grosses Risiko auf sich nehmen.»
Aber Ngima Gyalzen Sherpa sagt, das Bergsteigen sei immer gefährlich – egal, was man mache. Wer auf den Mount Everest will, geht an gefrorenen Leichen vorbei. Mehr als 300 Menschen starben auf dem Giganten – und viele Körper sind nach wie vor vor Ort – auch weil Bergungen aufwendig und teuer sind.
«Ich gebe meinen Gedanken an den Tod nicht viel Raum», sagt Sherpa. Ihm gefalle die Bergsteigerei gut und andere Jobs gebe es im Himalaja ohnehin kaum. «Aber ich vermisse jeweils meine Familie – besonders meine Mutter, die sich Sorgen um mich macht.»