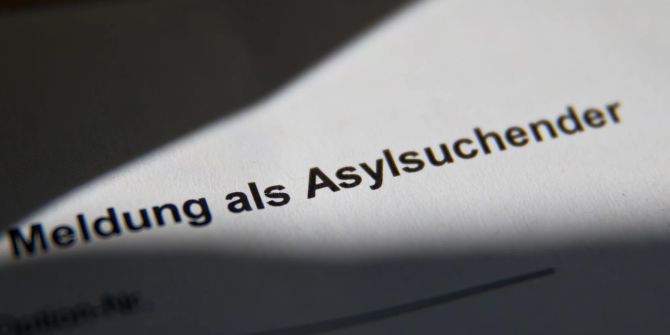EU bietet Grossbritannien intensivere Verhandlungen
Seit März machten die Gespräche über ein Handelsabkommen keine Fortschritte mehr. Boris Johnson und die EU-Spitzen zogen nun eine Zwischenbilanz.

Das Wichtigste in Kürze
- Die EU sprach mit Grossbritannien über künftige Handelsbeziehungen.
- Die Gespräche über ein Handelsabkommen machten lange keine Fortschritte.
- In einer Videokonferenz zogen Boris Johnson und die EU-Spitzen eine Zwischenbilanz.
Die Europäische Union will neuen Schub für die Gespräche mit Grossbritannien über die künftigen Handelsbeziehungen. «Die EU ist bereit, die Gespräche zu intensivieren, wir stehen rund um die Uhr bereit».
Dies schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montag vor einer Videokonferenz mit dem britischen Premier Boris Johnson auf Twitter. «Lasst uns neue Bewegung in die Verhandlungen bringen.»
Seit März hatten Unterhändler in den Gesprächen über ein Handels- und Partnerschaftsabkommen in vier intensiven Runden praktisch keine Fortschritte erreicht.
Nun zogen Johnson und die EU-Spitzen bei der Videokonferenz Zwischenbilanz. Auf EU-Seite nahmen daran auch Ratspräsident Charles Michel und Parlamentspräsident David Sassoli teil.
Preparing for videoconference with @BorisJohnson at 14.30, together with @EP_President and @eucopresident. The EU is ready to intensify the talks, we are available 24/7. Let’s inject fresh momentum into the negotiations. pic.twitter.com/9FFf9WC5tY
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2020
Grossbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. In einer Übergangsfrist bis zum Jahresende gehört das Land aber noch zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Im Alltag hat sich deswegen noch fast nichts geändert.
Anfang 2021 könnte es zum harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen kommen. Dies, wenn kein Vertrag über die künftigen Beziehungen gelingt.
«No Deal Brexit»
Johnson ist nach britischen Medienberichten bereit, bei weiterem Stillstand der Verhandlungen einen «No Deal Brexit» zum Jahresende hinzunehmen. Grossbritannien werde ab Januar eine unabhängige Handelsnation werden können, «egal was» bei den Verhandlungen mit Brüssel geschehe. Eine mögliche Verlängerung der Übergangsphase um ein oder zwei Jahre lehnt Johnson kategorisch ab. Die EU-Seite sagt inzwischen, damit sei dieses Thema wohl vom Tisch.
Schon vergangene Woche deutete sich an, dass beide Seiten nun bis Ende Juli noch einmal intensiv verhandeln wollen. Doch sind die Hürden hoch. Die EU bietet dem Vereinigten Königreich ein umfassendes Handelsabkommen mit Zugang zum EU-Markt ohne Zölle und Mengenbegrenzung. Dafür wird aber für gleiche Wettbewerbsbedingungen mit hohen Sozial-, Umwelt- und Verbraucherstandards gefordert.
Grossbritannien will jedoch keine Vorgaben der EU akzeptieren. Weitere wichtige Streitpunkte sind der Zugang von EU-Fischern zu den reichen britischen Fischgründen. Auch die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei Streitigkeiten der Vertragspartner ist ein Streitpunkt.

Aus Sicht Grossbritanniens könnte die langfristige Bindung an EU-Standards ein weitreichendes Handelsabkommen mit den USA verhindern. Das Versprechen von der Rückkehr zur globalen Handelsnation war zentral für die Brexit-Kampagne. Allerdings sind sich Experten einig, dass ein Abkommen mit Washington der Verlust des EU-Marktzugangs bei Weitem nicht wettgemacht würde.
Deutsche Wirtschaft warnt vor Bruch ohne Vertrag
Ähnlich sieht es bei der Fischerei aus. Sie ist für gerade einmal 0,1 Prozent der Bruttowertschöpfung in Grossbritannien verantwortlich. Aber ihre symbolische Bedeutung kann für die einstige Weltmacht zur See kaum überschätzt werden.
Zudem steht Johnson im Mai 2021 die erste grosse Prüfung seit seinem Wahlsieg bevor: Die Parlamentswahl in Schottland. Es sind vor allem die Fischer im Nordosten Schottlands, die sich von der Loslösung der gemeinsamen Fischereipolitik zusätzliche Einnahmen versprechen.
Die deutsche Wirtschaft warnt eindringlich vor einem Bruch ohne Vertrag. «Ein erschwerter Datenaustausch, die Einführung von Zöllen und die Unterbrechung von Lieferketten nach der Übergangsphase wären wahrscheinlich». Dies erklärte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Freitag. Unternehmen müssten sich auf unterschiedliche Standards gefasst machen: Deutlich längere Abfertigungszeiten für den Transport von Waren an den Grenzen und Zollanmeldungen.
Die negativen Folgen des Brexits müssten zumindest abgefedert werden. «Es bleibt die Hoffnung, den festgezurrten Gordischen Knoten am Montag noch etwas zu lockern», meinte Wansleben.