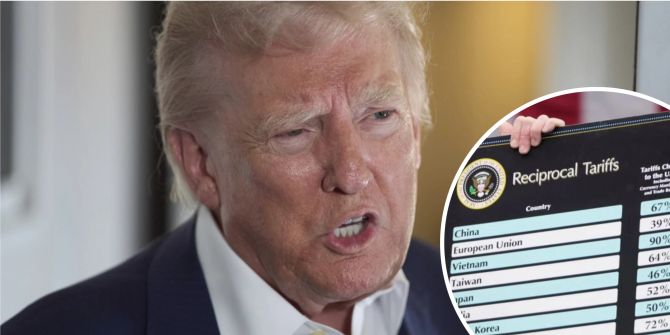Schutz gegen Finanzkrisen - Eurozonenbudget wird Realität
Frankreichs Präsident Macron forderte einst ein Multi-Milliarden-Budget für Euro-Staaten zum Schutz vor Finanzkrisen. Aus den Mühlen europäischer Kompromissfindung kam nun eine reduzierte Variante heraus. Ob diese ausreicht, muss sich zeigen.

Das Wichtigste in Kürze
- Das umstrittene Eurozonenbudget zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen wird nach gut zweijährigen Diskussionen Realität.
Die Euro-Finanzminister einigten sich in der Nacht auf Donnerstag in Luxemburg auf Grundsätze zur Finanzierung und Steuerung dieses Geldtopfes.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kann damit einen kleinen Erfolg verzeichnen. Wichtige Fragen sind aber noch offen. Ein Überblick über dieses und andere Ergebnisse des Treffens:
WOFÜR SOLL DAS EUROZONENBUDGET GUT SEIN?
Die Finanzkrise in Europa, bei der vor allem das hoch verschuldete Griechenland kurz vor der Pleite stand, zeigte den Euro-Staaten deutlich, dass wirtschaftliche Probleme in einem Land zu Turbulenzen führen können, die auch andere Länder treffen. Die Eurozone stand am Rand des Zusammenbruchs.
Um das gemeinsame Währungsgebiet besser gegen künftige Krisen zu wappnen, entstand die Idee eines eigenen Budgets. Es gehörte zu den Europa-Visionen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. 2017 sprach er sich für einen Multi-Milliarden-Haushalt ausschliesslich für die Euro-Staaten aus. Deutschland und Frankreich verständigten sich im vergangenen Jahr in Meseberg auf eine deutlich reduzierte Variante, die nun als Basis diente: einen gemeinsamen Geldtopf innerhalb des EU-Haushalts.
WIE SOLL DAS BUDGET NUN FUNKTIONIEREN?
Das Budget soll vor allem zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse dienen. Es soll für Euro-Staaten verfügbar sein sowie für Länder, die der Gemeinschaftswährung absehbar beitreten wollen.
Staaten sollen künftig jedes Jahr Reform- und Investitionspläne vorlegen, für die sie aus dem Budget Geld erhalten könnten. Die Eurostaaten und die EU-Kommission sollen diese bewerten, die Brüsseler Behörde sie letztlich absegnen.
Ein Grossteil der Gelder soll nach der Bevölkerung und dem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP) zugewiesen werden. Wirtschaftlich schwächere Staaten sollten verstärkt profitieren, erklärte Eurogruppenchef Mario Centeno.
Zudem soll eine nationale Kofinanzierungsrate von 25 Prozent gelten. Das bedeutet, dass ein Staat automatisch 25 Prozent an eigenem Geld zuschiessen muss, wenn er Mittel aus dem Eurozonenbudget erhält. In Krisenzeiten soll diese Rate halbiert werden können, sodass Staaten in Not weniger Geld aus den eigenen Haushalten dazu geben müssten.
WIE SOLL ES WEITERGEHEN?
Wie viel Geld im Eurozonenbudget drin sein wird, soll bei den Gesprächen zum EU-Haushaltsrahmen für 2021 bis 2027 entschieden werden. Im Gespräch sind 17 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, die Summe könne noch steigen.
Strittig ist zudem, ob einzelne Staaten sich zusammenschliessen und das Budget auf eigene Faust ausweiten könnten. Deutschland und Frankreich sind dafür, Widerstand kam vor allem von den Niederlanden. Die Entscheidung darüber wurde vertagt.
WAS SAGEN KRITIKER?
Kritische Stimmen gibt es vor allem im Europaparlament. «Die Finanzminister haben die grössenwahnsinnigen Ideen von Emmanuel Macron auf Normalmass zurechtgestutzt», sagte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. «Der Fokus auf Reformen und Wettbewerbsfähigkeit ist entscheidend, schliesslich muss sichergestellt werden, dass das Eurozonenbudget nicht dazu gebraucht wird, die Sozialausgaben der Mitgliedstaaten zu finanzieren.»
«Der vorgeschlagene Haushalt fördert Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit, hat aber nicht die dringend erforderliche stabilisierende Wirkung», sagte der Grünen-Finanzexperte Sven Giegold. «Dieser Vorschlag reicht bei weitem nicht aus, um den Euro wetterfest für die nächste Krise zu machen.»
WAS BESCHLOSSEN DIE FINANZMINISTER NOCH?
Sie strichen die Marshallinseln und die Vereinigten Arabischen Emirate von ihrer schwarzen Liste der Steuerparadiese. Mit dieser Liste sollen Staaten und Gebiete ausserhalb der EU zu besseren Steuerpraktiken bewogen werden. Sie war im Dezember 2017 unter anderem nach Enthüllungen in den Panama Papers über Firmengeflechte in Steuerparadiesen erstellt worden.
Die Schweiz, Mauritius und eine Reihe weiterer Länder wurden zudem von der grauen Liste gestrichen. Auf dieser befinden sich Staaten unter erweiterter Beobachtung. Sie hätten zugesagte und nötige Reformen umgesetzt, hiess es.
Kritik kam von der Hilfsorganisation Oxfam. Die EU habe zwei der schlimmsten Steueroasen «reingewaschen», sagte Oxfam-Steuerexpertin Chiara Putaturo mit Blick auf die Schweiz und Mauritius. Die Schweiz biete Firmen immer noch erhebliche Anreize und niedrige Steuersätze.
Die Euro-Finanzminister eröffneten zudem die KANDIDATENSUCHE für den frei werdenden Posten im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB). Sabine Lautenschläger ist derzeit die einzige Frau in dem sechsköpfigen Direktorium. Die 55-jährige Deutsche hatte Ende September überraschend mitgeteilt, dass sie das Führungsgremium der EZB Ende Oktober verlassen wird. Bis 24. Oktober sollten die Staaten nun Kandidaten nominieren, sagte Eurogruppenchef Centeno. Beim Treffen im November könnte dann eine Entscheidung fallen.