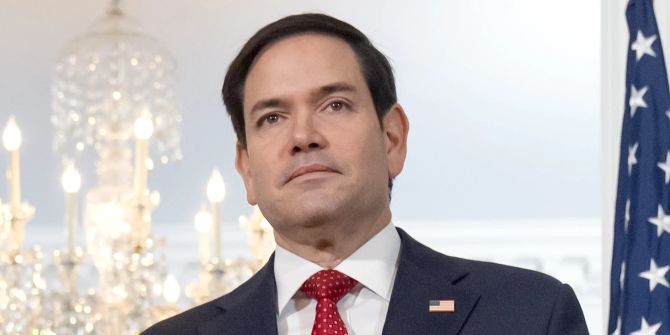Studie: Tropenwald von der Fläche Englands in 2018 zerstört
Mit der Zerstörung einer Fläche von knapp der Grösse Englands ist im vergangenen Jahr die dramatische Vernichtung der weltweiten Tropenwälder fortgesetzt worden.

Das Wichtigste in Kürze
- Experten wegen zentraler Rolle der Wälder beim Klimaschutz beunruhigt.
Rund 120.000 Quadratkilometer Tropenwald seien 2018 verloren gegangen, hiess es am Donnerstag im jährlichen Bericht von Global Forest Watch der US-Universität Maryland. Fast ein Drittel davon, rund 36.000 Quadratkilometer, waren demnach ursprünglicher Regenwald. Regenwälder spielen als CO2-Speicher eine zentrale Rolle beim Klimaschutz.
Laut Global Forest Watch wurde 2018 der viertgrösste Verlust von Tropenwäldern registriert, seit 2001 mit der Erhebung von Satellitendaten dazu begonnen wurde. Das Tempo der Zerstörung sei unverändert hoch, konstatierten die Experten. Minütlich verschwinde Wald von der Grösse von 30 Fussballfeldern.
Bei fast einem Drittel der betroffenen Flächen handelte es sich den Angaben zufolge um besonders schützenswerten Urwald der ältesten Generation, dem ursprünglichen Regenwald. Erstmals seien Eingriffe in den bislang unberührten natürlichen Regenwald dokumentiert, der aus jahrhundertealten, teils sogar jahrtausendealten Bäumen bestehe, sagte Forschungsgruppenleiterin Mikaela Weisse der Nachrichtenagentur AFP.
Regenwälder sind Lebensraum zahlreicher Arten und spielen überdies eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz. Frances Seymour, führende Wissenschaftlerin am Umweltinstitut World Ressources Institute in Washington, warnte: «Die Wälder der Welt sind jetzt in der Notaufnahme. Das Wohlergehen des Planeten steht auf dem Spiel.» Mit jedem verlorenen Hektar «kommen wir dem schrecklichen Szenario eines unkontrollierbaren Klimawandels näher», sagte Seymour.
In Brasilien war der Verlust am grössten. Der Anteil am Gesamtverlust an ursprünglichem Regenwald betrug in dem südamerikanischen Land mit rund 13.500 Quadratkilometern etwa ein Drittel. Der fortschreitende Waldverlust treffe mittlerweile auch Gebiete der Ureinwohner, die bislang unangetastet geblieben waren.
Überdies besteht die Befürchtung, dass sich die Lage weiter verschlimmert durch den neuen brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro, der im Januar sein Amt antrat. Er hat angekündigt, Umweltauflagen zu streichen und in Ureinwohner-Reservaten industrielle Landwirtschaft und Bergbau zuzulassen.
Nach Brasilien folgen bei der Waldvernichtung die Demokratische Republik Kongo mit 4800 Quadratkilometern, Indonesien mit 3400 Quadratkilometern, Kolumbien mit 1800 Quadratkilometern und Bolivien mit 1500 Quadratkilometern. Der afrikanische Inselstaat Madagaskar büsste im vergangenen Jahr zwei Prozent seines Regenwaldes ein.
Die Hauptverursacher der Zerstörung sind Viehzucht und Landwirtschaft: in Asien und Afrika vor allem der Anbau von Palmöl, in Südamerika Getreide zur Produktion von Biotreibstoffen.
Brandrodungen und Abholzungen zum Flächengewinn setzen dabei nicht nur klimaschädliches Kohlendioxid frei, sondern verringern auch die Kapazitäten der sogenannten grünen Lungen zur Aufnahme von CO2. Weltweit absorbieren die Wälder rund 30 Prozent des von Menschen verursachten Ausstosses von Treibhausgasen - mehr als elf Milliarden Tonnen pro Jahr.
Das bislang schlimmste Jahr für die weltweiten Wälder seit Beginn der Auswertungen war 2016, wozu das Wetterphänomen El Niño und grossflächige unkontrollierte Brände in Brasilien und Indonesien beitrugen. Für Brasilien zeigten die Daten einen deutlichen Trend hin zu von Menschen gelegten Feuern.