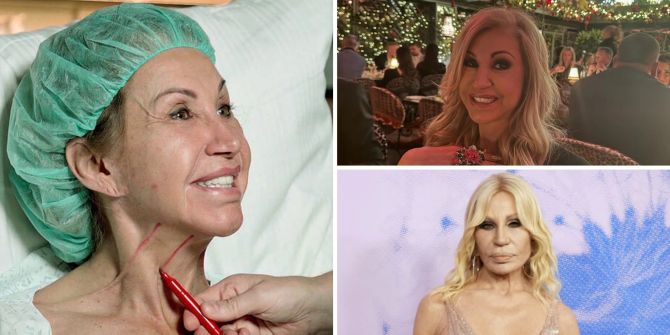Downsyndrom-Bluttests werden unter bestimmten Voraussetzungen zur Kassenleistung
Bluttests zur Erkennung des Downsyndroms werden künftig unter bestimmten Voraussetzungen von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

Das Wichtigste in Kürze
- Kosten sollen «in begründeten Einzelfällen» übernommen werden.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen entschied am Freitag, dass die Kosten «in begründeten Einzelfällen und nach ärztlicher Beratung» erstattet werden sollen. Dies wird aber wohl erst ab dem Herbst kommenden Jahres geschehen. Der Beschluss stiess auf ein geteiltes Echo.
Bei den Blutuntersuchungen wird sogenannte fetale DNA im Blut von Schwangeren analysiert, um Chromosomenstörungen nachzuweisen, die zu Trisomie führen - dem Downsyndrom. Die Tests gibt es bereits seit Jahren, sie sind allerdings keine Kassenleistung. Voraussetzung für die Erstattung ist dem jetzigen Beschluss zufolge eine verpflichtende Versicherteninformation, die den Angaben zufolge Ende 2020 vorliegen soll.
Die Kassen sollen die Untersuchung dem Beschluss zufolge erstatten, wenn im Rahmen der ärztlichen Schwangerenbetreuung die Frage aufkommt, ob eine Trisomie vorliegen könnte - und dies für die Schwangere eine unzumutbare Belastung darstellt. Ziel ist es, den Frauen die invasive Untersuchung zu ersparen, die mit dem Risiko einer Fehlgeburt einhergeht.
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) fürchtet nach der Entscheidung einen Anstieg der Schwangerschaftsabbrüche von Kindern. «Zudem wird einer immer weitergehenden Qualitätskontrolle hinsichtlich des ungeborenen Lebens der Weg gebahnt», erklärte ZdK-Präsident Thomas Sternberg. «Denn es dürfte nicht bei den derzeit verfügbaren Tests bleiben.»
Die Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie erklärte, die Entscheidung zur Kostenerstattung stehe im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention, die die Rechte von Menschen mit Behinderung schütze.
Auch der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, mahnte: Familien mit behinderten und pflegebedürftigen Kindern müssten mehr Respekt, Anerkennung und staatliche Unterstützung erfahren. «Die modernen medizinisch-technischen Methoden können wir nicht aus der Welt schaffen, aber die Haltung zu Kindern mit Behinderungen, die Behinderung als Makel zu betrachten oder als Bürde für die Eltern, die müssen wir ändern.»
Die Linken-Abgeordnete Kathrin Vogler äusserte die Befürchtung, dass die Entscheidung zur Erstattung der Trisomietests einen Präzedenzfall schaffen könne. Denn es gebe «tausende genetische Normabweichungen, von denen hunderte mit dieser Methode bereits diagnostizierbar wären», erklärte sie. «Deswegen brauchen wir eine gesellschaftliche und politische Debatte darüber.»
Hingegen begrüsste die Vorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt, die Entscheidung des G-BA im Grundsatz. Es gehe um begründete Einzelfälle, bei denen mehr Faktoren für eine solche Untersuchung in Betracht gezogen würden als nur das Alter der werdenden Mutter, sagte die SPD-Politikerin und frühere Bundesgesundheitsministerin im Deutschlandfunk.
Sie habe Verständnis dafür, wenn Eltern wissen wollten, ob ihr Kind genetisch vorbelastet sei, sagte Schmidt. Es dürfe aber nicht zu einer Debatte in Deutschland kommen, dass sich Eltern von behinderten Kindern fragen lassen müssten, ob sie das nicht hätten verhindern können.