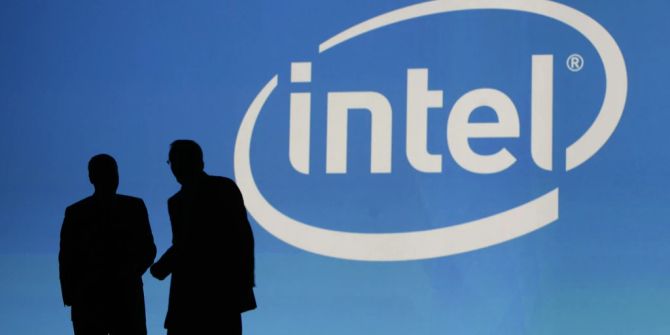Einkommensunterschiede in Deutschland auf Rekordmass
Die Einkommen der Bürger in Deutschland waren zuletzt so ungleich verteilt wie nie.

Das Wichtigste in Kürze
- Forderungen nach höherem Mindestlohn und Wiedereinführung der Vermögenssteuer.
Während die Bevölkerung mit mittlerem Einkommen angesichts «der über Jahre guten wirtschaftlichen Entwicklung» zugenommen habe, seien die Unterschiede zwischen Gering- und Vielverdienern auf ein Rekordmass gewachsen, erklärte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Montag. Sozialverbände und Politiker von SPD und Grünen forderten unter anderem eine Vermögensteuer sowie eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze.
Wie das WSI bei der Vorstellung seines Verteilungsberichts hervorhob, entwickeln sich die Einkommen in Ostdeutschland «deutlich schneller auseinander als im Westen». «Hohe Einkommensgruppen haben von sprudelnden Kapital- und Unternehmenseinkommen profitiert und dadurch die grosse Mehrheit der Haushalte in Deutschland beim verfügbaren Einkommen deutlich hinter sich gelassen», hiess es. Der Bericht basiert auf den Daten des sozio-oekonomischen Panels (SOEP).
Demnach ist der Anteil deutscher Haushalte, die unter der Armutsgrenze von 60 Prozent des mittleren Einkommens liegen, von 14,2 Prozent im Jahr 2010 auf 16,7 Prozent 2016 gewachsen. Armen Haushalten fehlten in diesem Jahr im Schnitt gut 3400 Euro zu dieser Armutsgrenze. Die Quote reicher Haushalte mit über 200 Prozent des mittleren Einkommens blieb laut WSI im gleichen Zeitraum stabil bei rund acht Prozent.
Trotz des positiven Trends, dass diejenigen, die eine feste, reguläre Arbeitsstelle haben, zuletzt auch nach Abzug der Inflation spürbar mehr Einkommen zur Verfügung gehabt hätten, nehme die Polarisierung in Deutschland weiter zu. Das liege unter anderem am grossen Niedriglohnsektor.
Es seien die Ränder, an denen «die entscheidenden Entwicklungen stattfinden», erklärte das WSI. Die Steuerpolitik der vergangenen zwei Jahrzehnte habe die Ungleichheit begünstigt. Dem Institut zufolge profitierten reiche Haushalte von der Senkung des Spitzensteuersatzes oder der Reform der Erbschaftsteuer, während ärmere Haushalte durch höhere indirekte Steuern zusätzlich belastet wurden. Das WSI forderte daher eine stärkere Tarifbindung und höhere Steuern auf Spitzeneinkommen, ebenso wie eine Erhöhung des Mindestlohns und der Hartz-IV-Regelsätze.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband forderte die Bundesregierung auf, umgehend die Grundsicherungsleistungen anzuheben und darüber hinaus eine Kindergrundsicherung und die Grundrente einzuführen. «Wer die schwarze Null zum Fetisch und zugleich Umverteilung zum Tabu erklärt, muss sich über dieses Ergebnis seiner Politik nicht wundern», erklärte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Nach Berechnungen des Paritätischen müssten die Hartz-IV-Regelsätze um mindestens 37 Prozent auf dann 582 Euro erhöht werden. «Die Zeit der kleinen Trippelschritte muss endlich vorbei sein», erklärte Schneider.
Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, erklärte: «Es läuft viel schief, wenn allein Wohlhabende von der guten Konjunktur und steigenden Kapital- und Unternehmenseinkommen profitieren und sich dadurch immer weiter von der Mehrheit der Menschen und ihren Einkommen entfernen.» Neben einem Mindestlohn von zwölf Euro verlangte sie «gute Stundenlöhne», mehr Tarifbindung und eine Eindämmung der Jobs im Niedriglohnsektor.
Für die SPD-Fraktion verlangte die Sprecherin für Arbeit und Soziales, Kerstin Tack, die Vermögenssteuer müsse wieder eingesetzt werden, um Vermögen von oben nach unten umzuverteilen.
Grünen-Fraktionsvize Anja Hajduk erklärte, die Studie offenbare «einmal mehr die verfehlte Sozial- und Steuerpolitik» der GroKo. Diese ziehe es vor, «Geld mit der Giesskanne zu verteilen, anstatt strukturelle Ungerechtigkeiten im Steuersystem anzugehen».