Beschwerde einer behinderten Arbeitnehmerin in Genf gutgeheissen
Eine an Multiple Sklerose erkrankte Frau wurde nach der Geburt ihrer Tochter entlassen. Sie verklagte ihren Arbeitgeber wegen Diskriminierung.
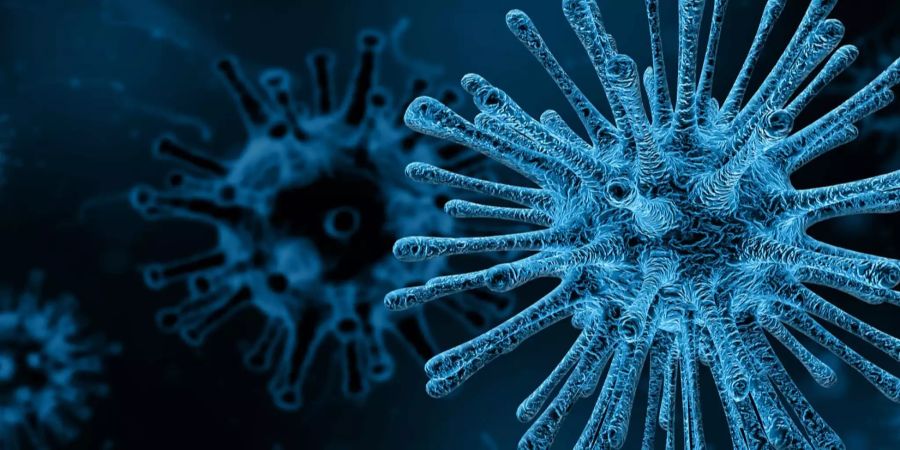
Das Wichtigste in Kürze
- Eine Frau mit Behinderung verklagte ihren Arbeitgeber wegen Diskriminierung.
- Die Klage der an Multiple Sklerose erkrankten Frau wurde vom Gericht gutgeheissen.
Eine Frau mit Behinderung hat nach ihrer Entlassung durch das Hospice général des Kantons Genf über Diskriminierung geklagt. Das Bundesgericht hiess ihre Beschwerde teilweise gut, da es der Ansicht war, dass ihre Vorwürfe nicht ausreichend untersucht worden seien. Das Kantonsgericht muss nun nochmals über die Bücher. Inclusion Handicap spricht von einem «wichtigen Erfolg».
Die an Multipler Sklerose erkrankte Beschwerdeführerin verlor ihre Stelle beim Hospice général, einer öffentlich-rechtlichen Sozialhilfeeinrichtung des Kantons Genf. Die Kündigung erreichte sie etwa ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Ende Juni 2020. Sie hatte dort seit 2017 als Beraterin für berufliche Wiedereingliederung und später als Sozialarbeiterin gearbeitet.
Symptome nahmen durch Schwangerschaft zu
Ihr Arbeitgeber hatte ihren befristeten Vertrag mehrmals verlängert. Die Auswirkungen ihrer Krankheit wurden durch die Schwangerschaft verstärkt, wie Inclusion Handicap in einer Mitteilung festhält.
Obwohl ihre behandelnde Ärztin ihr eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit attestierte, weigerte sich das Hospice général, ihren Vertrag zu verlängern. Dies trotz seiner gängigen Praxis, Personal befristet anzustellen und es bei Zufriedenheit dauerhaft zu beschäftigen. Zudem waren mehrere Stellen offen, auf die sich die Beschwerdeführerin ordnungsgemäss beworben hatte.
Diskriminierung durch Hospice général
Zuvor hatte sich der Vertrauensarzt des Arbeitgebers gegenüber der behandelnden Ärztin abfällig über die Beschwerdeführerin geäussert: «Madame fait désordre dans les locaux et choque» (sinngemäss: «Die Frau ist unordentlich und schockiert»).
Die Beschwerdeführerin schloss aus alldem, dass sie vom Hospice général diskriminiert worden sei, obwohl ihre Arbeit zufriedenstellend gewesen sei. Sie war insbesondere der Ansicht, dass sie aufgrund ihrer Behinderung und ihrer Schwangerschaft von ihrem Arbeitsplatz ferngehalten worden sei.
Kantonsgericht muss Fall erneut prüfen
Das Kantonsgericht stellte nicht fest, dass die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses auf blossen Vorurteilen im Zusammenhang mit diesen Elementen beruhte. Es lehnte es ab, die behandelnde Ärztin als Zeugin anzuhören, um den Sachverhalt zu ermitteln. Es verlangte auch nicht, dass der Arbeitgeber Dokumente über die Praxis bei der Einstellung und Weiterbeschäftigung von Personal vorlegt.
In seinem Urteil vom 14. April hiess das Bundesgericht die Beschwerde insofern teilweise gut, als es sie an die Vorinstanz zurückwies. Es forderte das Kantonsgericht auf, den Fall erneut zu prüfen und neu zu entscheiden.
Diskriminierung nicht mit Bundesverfassung vereinbar
Gemäss den Richtern verletzte die Vorinstanz den Anspruch auf rechtliches Gehör. Weil sie die von der Beschwerdeführerin angebotene Zeugenaussage und die Beweismittel ablehnte. Diese hätten möglicherweise belegen können, dass der öffentlich-rechtliche Arbeitgeber die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert habe. Eine solche Diskriminierung ist laut dem Bundesgericht nicht mit der Uno-Konvention und der Bundesverfassung vereinbar.

Inclusion Handicap, welche die Beschwerdeführerin im Verfahren vertreten hat, begrüsst den Entscheid: «Es ist interessant und erfreulich, dass das Bundesgericht den Schutz ins Zentrum seiner Argumentation stellt.» Dies hält der Dachverband der schweizerischen Behindertenorganisationen fest.
Das Bundesgericht halte erstmals fest, dass das Diskriminierungsverbot wegen einer Behinderung die Behörden verpflichte, Vorkehrungen am Arbeitsplatz zu treffen. Es erinnere zudem daran, dass dieses völkerrechtliche Verbot der Diskriminierung für Schweizer Gerichte direkt anwendbar sei.
Welche Folgen das Vorliegen einer Diskriminierung haben wird, lasse das Bundesgericht zwar ausdrücklich offen. Es habe dem Gericht zu verstehen gegeben, dass sowohl die Uno-Konvention als auch die Verfassung ernst genommen werden müssten.












