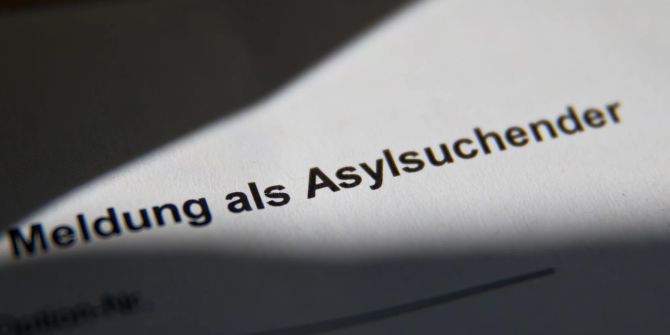Das bedeutet knappes Ja zu EU-Referendum in Moldau
In Moldau haben sich die proeuropäischen Kräfte in einer wichtigen Abstimmung knapp durchgesetzt. Ein Experte ordnet das Resultat ein.

Das Wichtigste in Kürze
- Ein Pro-EU-Referendum wurde in Moldau mit knapp über 50 Prozent angenommen.
- Das Resultat fiel nicht so deutlich aus, wie die Befürworter das gerne gehabt hätten.
- Das Land ist gespalten – und diese Spaltung könnte vom Kreml noch vorangetrieben werden.
Es war ein regelrechter Abstimmungskrimi, der sich im kleinen osteuropäischen Land Moldau abspielte.
Lange sah es danach aus, als ob die Bevölkerung ein Pro-EU-Referendum ablehnen würde. Erst ganz am Ende der Auszählung am Montag lagen die Befürworter plötzlich vorne.
Am Ende sagte die Republik mit 50,38 Prozent Ja. Damit wird der EU-Beitritt als strategisches Ziel in die moldauische Verfassung geschrieben.
Befürworter hofften auf deutlicheres Ja zur EU
Osteuropa-Experte Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen erklärt gegenüber Nau.ch zunächst, dass Moldau nicht das erste Land mit einer solchen Verfassungsbestimmung ist. Die Republik Moldau folge damit dem Beispiel der Ukraine und Georgiens.
So bald dürfte das zwischen Rumänien und der Ukraine gelegene Land aber nicht der Brüsseler Union beitreten. Auch wenn das Referendum angenommen wurde. Schmid erklärt: «Es macht den Weg für den Beginn des Aufnahmeprozesses frei, der aber aufwendig, schwierig und lange sein wird.»
Dazu kommt, dass das Resultat für die Befürworter um Präsidentin Maia Sandu nicht gänzlich positiv interpretiert werden kann. Schmid erklärt: «Maia Sandu hat auf ein 60:40 Ergebnis gehofft. Es war aber klar, dass der Ausgang des Referendums sehr knapp ausfallen würde.»
Das Ergebnis zeigt nämlich auch, dass die proeuropäischen Kräfte viel Gegenwind haben. «In der Tat kann man von einer gespaltenen Gesellschaft in der Moldau sprechen», so Schmid. Denn auch das prorussische Lager ist im Land präsent. «Es gibt viele Menschen, die Russisch sprechen und die Inhalte der russischen Staatsmedien konsumieren.»
Präsidentin verpasst sofortige Wiederwahl – hat aber weiterhin gute Chancen
Neben dem EU-Referendum fand in Moldau am Wochenende auch die Präsidentschaftswahl statt. Amtsinhaberin Maia Sandu erhielt dabei zwar die meisten Stimmen, muss aber in eine Stichwahl.
Laut Schmid hat das durchaus auch mit dem Referendum zu tun. «Maia Sandu hat ihre Wiederwahl bewusst mit der EU-Referendumsfrage verknüpft», so der Experte. Damit habe sie sich für eine konsequente, aber riskante Strategie entschieden.
Schmid führt aus: «Bei dieser Konstellation konnte erwartet werden, dass die bisherige Präsidentin nicht im ersten Wahlgang im Amt bestätigt wird.» Die Chancen im zweiten Wahlgang stehen laut ihm aber gut. Es dürfte am 3. November zum Duell mit dem als prorussisch geltenden Alexandru Stoianoglo kommen.
Sandu hat bereits vor dem Feststehen der Resultate Wahlmanipulationsvorwürfe geäussert. Laut Schmid sind diese «gut begründet». «Im Vorfeld der Wahlen hat der verurteilte moldauische Oligarch Ilan Sor aus Moskau die Fäden gezogen.» Im Raum stehen beispielsweise Propaganda oder Stimmenkäufe.
Kremlsprecher Dmitri Peskow forderte von Sandu Beweise für ihre Vorwürfe. Er sagte russischen Agenturen zufolge: «Wenn sie sagt, dass sie wegen irgendwelcher krimineller Banden zu wenig Stimmen bekommen hat, sollte sie die Beweise vorlegen.»
Keine offene Militär-Intervention – aber mehr Destabilisierungsversuche
Klar ist: Das Resultat aus der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau dürfte dem Kreml um Präsident Wladimir Putin nicht gefallen.

Schmid sagt zu einer möglichen Reaktion Russlands: «Die Moldau passt als ehemaliges Gebiet sowohl des Zarenreichs als auch der Sowjetunion perfekt in das Beuteschema des Kremls.» Allerdings sei eine offene russische Intervention «auf absehbare Zeit unwahrscheinlich». Die militärischen Ressourcen seien in der Ukraine gebunden.
Destabilisierungsversuche dürfte es aber weiterhin geben – sie könnten sich sogar verstärken. «Der Kreml wird auf eine weitere Spaltung der moldauischen Gesellschaft hinarbeiten», so Schmid.