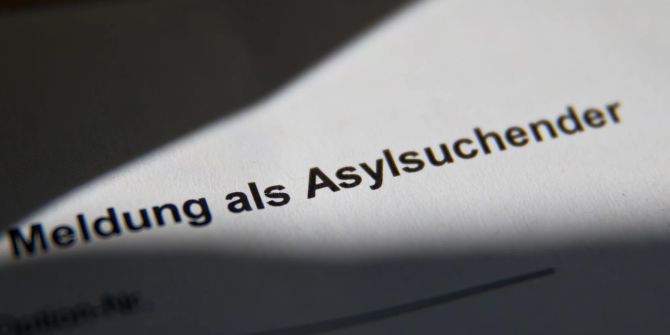Johnson fliegt wegen Brexit-Handelsabkommen persönlich nach Brüssel
Um ein No-Deal-Szenario zu verhindern, müssen die EU und Grossbritannien bis Jahresende ein Handelsabkommen schliessen. Johnson will es nun selbst richten.

Das Wichtigste in Kürze
- Die EU und Grossbritannien verhandeln noch immer über das Brexit-Handelsabkommen.
- Die Zeit wird jedoch langsam knapp.
- Der britische Premier fliegt nun persönlich nach Brüssel.
Deal oder kein Deal: Im Drama um ein Handelsabkommen nach dem Brexit fliegt der britische Premier Boris Johnson nun persönlich nach Brüssel.
Am Mittwoch trifft er dort EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen zum Abendessen, um die Möglichkeiten für eine Vereinbarung in den seit Monaten festgefahrenen Verhandlungen auszuloten. Die Chancen auf einen Durchbruch sind ungewiss.
«Abkommen ist noch immer möglich»
Vor seiner Abreise schlug Johnson einen optimistischeren Ton an: «Ein gutes Abkommen ist noch immer möglich», sagte er in London. Am Dienstag hatte Johnson noch erklärt, London und Brüssel seien von einem Abkommen «weit voneinander entfernt».
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten: «Es gibt nach wie vor die Chance eines Abkommens, wir arbeiten weiter daran», sagte die Kanzlerin im Bundestag. Die EU sei aber bei nicht zu akzeptierenden Bedingungen von britischer Seite auch darauf vorbereitet, einen «Weg ohne Austrittsabkommen» zu gehen.

Beide Seiten haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Kompromissbereitschaft angemahnt, um ein Scheitern der Gespräche und ein No-Deal-Szenario zum 1. Januar mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft zu verhindern. Inzwischen ist die Zeit für die rechtzeitige Ratifizierung eines Abkommens bis zum Jahresende äusserst knapp.
Merkel sieht Bedingungen für fairen Wettbewerb als Knackpunkt
Die «eigentlich grosse Frage» bei den Verhandlungen seien die Bedingungen für einen fairen Wettbewerb, sagte Merkel. In diesem Punkt brauche es «befriedigende Antworten».
Denn die EU hat Grossbritannien weiter umfassenden Zugang zum europäischen Binnenmarkt ohne Zölle und Mengenbeschränkungen in Aussicht gestellt. Brüssel fordert dafür aber, dass die Briten sich auch in Zukunft an EU-Standards etwa im Umwelt- oder Sozialbereich halten und Firmen auf dem Kontinent nicht durch unfairen Wettbewerb unterbieten.
Derzeit keine Kompromissbereitschaft der EU bei Standards
Johnson forderte die EU zur Kompromissbereitschaft bei den EU-Standards auf. Die EU bestehe derzeit darauf, dass Grossbritannien ihre neuen Gesetze und Regelungen übernehme, sagte er. Ansonsten wolle sie «automatisch das Recht (....), uns zu bestrafen und zurückzuschlagen».
Weitere Streitpunkte sind die Kontrolle eines Abkommens und die Streitschlichtung sowie die künftigen Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern. Letztere sind vor allem Ländern wie Frankreich, Dänemark oder Spanien wichtig.

Der irische Aussenminister Simon Coveney warnte im irischen Rundfunk, die Hoffnungen auf einen Durchbruch sollten «nicht zu hoch» angesetzt werden. «Mit der richtigen Herangehensweise» könnten die Streitpunkte ausgeräumt werden. «Aber die Unfähigkeit, sie bis heute zu lösen, bedeutet, dass ein Scheitern in dieser Phase durchaus möglich ist.»
Streitpunkt zu Nordirland ausgeräumt
Vor dem Spitzentreffen in Brüssel hatten beide Seiten am Dienstag einen wichtigen Streitpunkt zu Nordirland ausgeräumt. Demnach verzichtet London darauf, einseitige Änderungen am bereits geltenden Brexit-Vertrag in diesem Bereich vorzunehmen. EU-Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic hatte dies als möglichen «positiven Impuls» für die Handelsgespräche bezeichnet.

Grossbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, doch bleibt das Land noch bis Jahresende im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. In der Übergangsphase ist es bisher nicht gelungen, ein Post-Brexit-Handelsabkommen auszuhandeln.
Ohne Einigung würden im beiderseitigen Handel zum Jahreswechsel Zölle erhoben. Wirtschaftsverbände rechnen dann nicht nur mit massiven Staus an den Grenzen im Lieferverkehr, sondern auch mit Milliarden an Mehrkosten und Einnahmeausfällen.