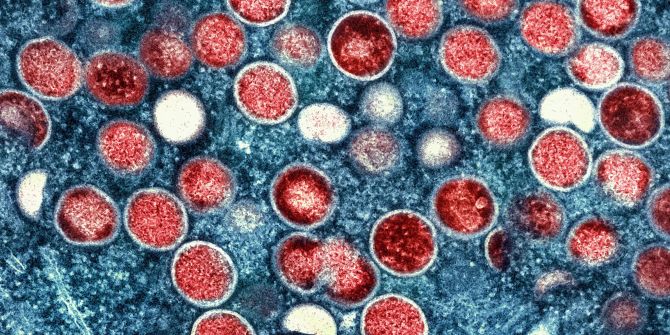Mutation könnte Coronavirus noch gefährlicher machen
Millionen Menschen haben sich bereits mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. US-Forschenden zufolge könnte eine Mutation das Virus noch gefährlicher machen.
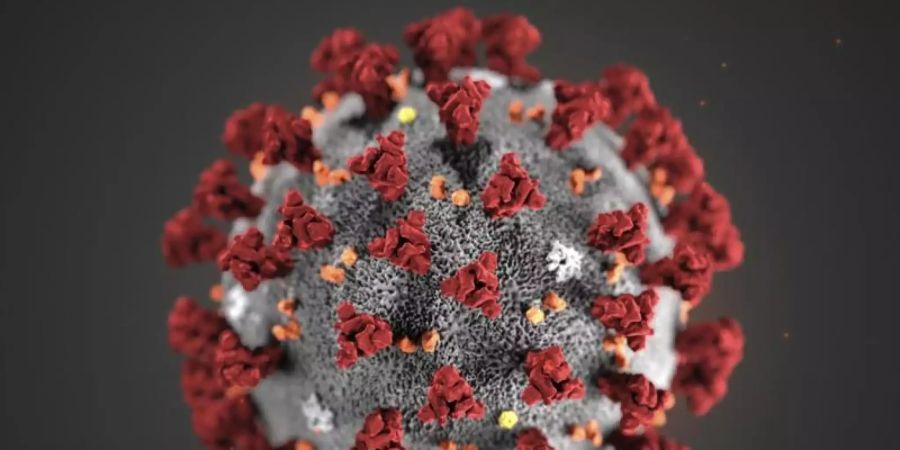
Das Wichtigste in Kürze
- Das neuartige Coronavirus könnte zu einer noch gefährlicheren Form mutieren.
- US-Forscher vermuten dies in einer neuen Analyse.
Eine Analyse aus den USA lässt aufhorchen: Sars-CoV-2 könnte zu einer noch gefährlicheren Variante mutiert sein, heisst es da. Experten haben daran grosse Zweifel. So wirklich nötig habe das Coronavirus Veränderungen auch gar nicht – es sei schon ziemlich gut angepasst.
Eine Mutation mit der Bezeichnung D614G macht das Virus infektiöser. Dies schliessen Forschende des amerikanischen Scripps Research Institutes in einer noch nicht begutachteten Preprint-Veröffentlichung aus Genomanalysen. Unter Laborbedingungen könne der Erreger mehr Zellen infizieren, berichtete das Team kürzlich.
Zufälle spielen bei Mutation eine grosse Rolle
Die D614G-Mutation sei in den in Europa und an der Ostküste der USA kursierenden Virusstämmen tatsächlich stark präsent. Richard Neher von der Universität Basel erklärte dazu: «Aus dieser Dominanz lässt sich aber nicht schliessen, dass sich das Virus mit der Mutation schneller verbreitet.»
Die Dominanz sei nicht zwingend auf eine höhere Übertragungsrate oder Virulenz zurückzuführen. Sondern auf den Zufall, erklärt der Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien: Die D614G-Virusvariante habe am Beginn einzelner grösserer Ausbrüche gestanden und sich in der Folge stärker ausgebreitet als andere Varianten. «Zufälle spielen gerade am Anfang eine unglaublich grosse Rolle.»
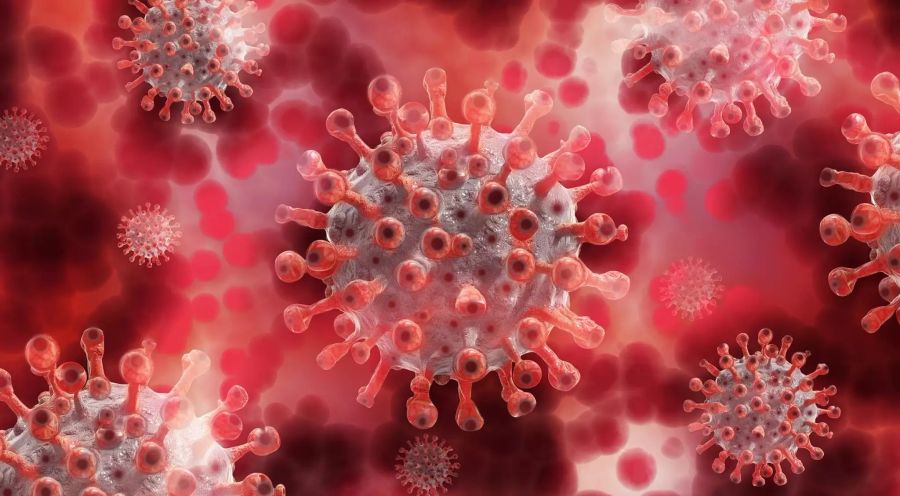
Generell seien Mutationen bei dem Coronavirus absolut nicht ungewöhnlich, betont Neher. In seinen 30'000 Basen komme es im Mittel alle zwei Wochen zu einer Mutation. Damit sei die Mutationsrate pro Base etwas niedriger als etwa bei Influenza oder HIV. Wegen des grösseren Genoms von Sars-CoV-2 sei der Wert sei sie aber letztlich in etwa gleich.
Anhand der Mutationen könne man darauf schliessen, ob zwei Ausbrüche zusammenhängen. Infektionsketten von Mensch zu Mensch seien darüber nicht nachzuvollziehen. Beim jüngsten Ausbruch in Peking beispielsweise lassen Genomvergleiche demnach darauf schliessen, dass der Erreger von aussen ins Land eingeschleppt wurde. Woher genau, sei nicht zu sagen.
Medikamente meist unempfindlich gegenüber Einzelmutationen
Sars-CoV-2 sei schon sehr gut an den Menschen angepasst, sagt Friedemann Weber. Er ist Direktor des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Giessen. «Da frage ich mich schon erst mal: Was braucht es mehr?»
Laut einer aktuellen Studie verleihe die D614G-Mutation allerdings etwas mehr Stabilität, dies könne für die Partikel durchaus ein Vorteil sein. Dass eine einzelne Mutation einen grossen Unterschied mache, sei insbesondere bei einem auf nur ein bestimmtes Enzym wirkendes Medikament denkbar. Viele Medikamente und auch Impfstoffkandidaten seien aber auf breiterer Basis aufgestellt und daher zumeist unempfindlich gegenüber Einzelmutationen.
Derzeit sei weltweit kein einziges Virus-Isolat mit veränderter Pathogenität bekannt, betont Neher auch. «Wir können nicht ausschliessen, dass es sie gibt, es ist aber eher unwahrscheinlich.»
Sein Team hat gemeinsam mit US-Kollegen die Webanwendung «Nextstrain» entwickelt. Damit lässt sich über eingespeiste Genomsequenzen verfolgen lässt, über welche Wege sich Viren ausbreiten. Die Software analysiert, wie sich ein Erreger verändert. Also welche Mutationen er während der Ausbreitung ansammelt – eine Art Stammbaum entsteht.