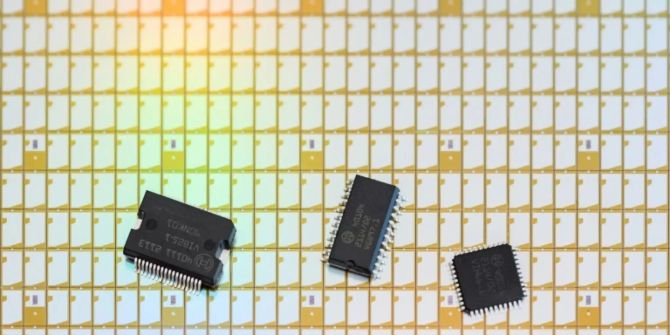Sonnensturm bei schwachem Erdmagnetfeld Gesundheitsrisiko
Extrem starke solare Strahlungsstürme (SPE) trafen die Erde in der Erdgeschichte. Bei abgeschwächtem Magnetfeld kann dies Umwelt sowie Gesundheit gefährden.

Die meisten der bei Sonneneruptionen beschleunigten, geladenen Teilchen werden vom Erdmagnetfeld abgelenkt. Allerdings trafen im Laufe der Erdgeschichte auch extrem starke solare Strahlungsstürme (Solar Particle Events, SPE) die Erde. Passiert dies in Phasen mit einem abgeschwächten Magnetfeld, kann dies zu verstärktem Abbau des vor UV-Strahlung schützenden stratosphärischen Ozons führen und damit Umwelt und Gesundheit gefährden.
Das Magnetfeld der Erde spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz des Lebens und technischer Infrastruktur wie Satelliten. Dies schreiben die Forscherinnen und Forscher um Pavle Arsenovic vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien in ihrer Arbeit. In seiner derzeitigen Stärke lenkt es den Grossteil der kosmischen Strahlung, die ständig von der Sonne bzw. aus dem Universum auf die Erde eintrifft, ab und verhindert so das Eindringen der meisten hochenergetischen Teilchen in die unteren Schichten der Atmosphäre.
Extreme Strahlungsstürme
Aus der Analyse von Klimaarchiven wie Baumringen und Eisbohrkernen weiss man allerdings, dass es in der Erdgeschichte extreme Strahlungsstürme (Solar Particle Events (SPE) gegeben hat. Diese treten in unregelmässigen Abständen, etwa alle paar Jahrtausende, auf. Solche extremen Protonenströme während Sonneneruptionen haben «das Potenzial, die Chemie der Atmosphäre zu verändern und dadurch die Umweltbedingungen und das Leben auf der Erde zu beeinflussen».
Speziell wenn das schützende geomagnetische Feld der Erde schwächer ist, wären die Auswirkungen extremer SPE viel gravierender. Geologischen Befunden zufolge gab es im Laufe der Erdgeschichte immer wieder Phasen mit einem deutlich schwächeren Erdmagnetfeld als heute. Das war etwa immer dann der Fall, wenn sich die Polarität des Magnetfelds umgekehrt hat – einen solchen «Polsprung» gab es vor etwa 42'000 Jahren – oder bei Veränderung der Geometrie des Erdmagnetfelds, die zu einer ausgeprägten Verringerung der geomagnetischen Feldstärke führt.
Arsenovic und seine Kolleginnen und Kollegen haben in ihrer nun veröffentlichten Arbeit modelliert, welche Auswirkungen extreme SPEs auf die Atmosphärenchemie und die Strahlung an der Erdoberfläche bei unterschiedlichen geomagnetischen Feldstärken haben. Das ist auch angesichts von Messungen relevant, die darauf hindeuten, dass sich die Stärke des Erdmagnetfelds im vergangenen Jahrhundert um rund zehn Prozent abgeschwächt hat. Was zu Spekulationen um einen eventuell bevorstehenden «Polsprung» geführt hat.
Anstieg des UV-Indexes um 20 bis 25 Prozent
Die Forscher zeigten, dass «unter den derzeitigen geomagnetischen Bedingungen ein extremer SPE die Konzentrationen von Stickoxiden in der Stratosphäre und Mesosphäre über den Polen erhöhen würde». Die Folge wäre eine Verringerung der schützenden Ozonschicht in der Stratosphäre in den Polarregionen und gemässigten Breiten für etwa ein Jahr.
Dagegen würde ein extremer SPE während einer Phase mit einem deutlich schwächeren Erdmagnetfeld die Stickoxidkonzentration in der gesamten Atmosphäre erheblich ansteigen lassen. Wodurch das stratosphärische Ozon weltweit über mehrere Jahre hinweg stark abgebaut würde. «Das würde zu einem Anstieg des UV-Indexes um 20 bis 25 Prozent führen und die durch die erhöhte UV-Strahlung verursachten DNA-Schäden um 40 bis 50 Prozent erhöhen», heisst es in der Arbeit.
Dass sich Veränderungen der chemischen Zusammensetzung höherer Atmosphärenschichten bis zum Boden auswirken können, «ist auch im Kontext des fortschreitenden Klimawandels bedeutsam. Da SPEs künftig unter deutlich veränderten Umweltbedingungen auftreten und somit noch zusätzliche Herausforderungen für Ökosysteme und menschliche Gesundheit darstellen könnten», erklärte Co-Autor Harald Rieder vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Boku.