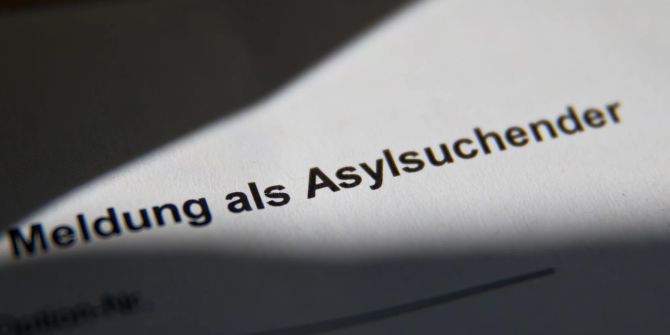EU Kommissionspräsident wird trotz Reform nicht direkt gewählt
Der EU-Kommissionspräsident wird seit dem Reformvertrag von Lissabon mit dem Parlament bestimmt. Eine Direktwahl gibt es nach wie vor nicht.

Das Wichtigste in Kürze
- Die Europäischen Union führte ein Spitzenkandidat-Prozess für mehr Wahlbeteiligung ein.
- Eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten durch den EU-Bürger ist aber nicht möglich.
Über Jahrzehnte haben die EU-Staats- und Regierungschefs die Besetzung des Postens des Präsidenten der Europäischen Kommission in Hinterzimmerdeals ausgehandelt. Durch den Reformvertrag von Lissabon wurde dem EU-Parlament ein Mitspracherecht eingeräumt.
Die dortigen Parteien hatten deshalb bei der Europawahl 2014 erstmals «Spitzenkandidaten» aufgestellt. Im finnischen Helsinki kürt nun die Europäische Volkspartei (EVP) ihren Spitzenkandidaten für 2019 und die Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Für mehr Wahlbeteiligung
In Artikel 17 des EU-Vertrags ist der Spitzenkandidaten-Prozess eher indirekt angelegt. Dort heisst es: Der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs schlägt dem Europäischen Parlament «einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der EU-Kommission vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament.» Das Parlament muss den vorgeschlagenen Kandidaten dann «mit der Mehrheit seiner Mitglieder» wählen.
Die Änderung sollte den Europawahlkampf angesichts stetig sinkender Wahlbeteiligung lebhafter und interessanter machen. Eine wirkliche «Direktwahl» des Kommissionspräsidenten durch die EU-Bürger ist das Spitzenkandidaten-Verfahren aber nicht. Und unumstritten war es schon 2014 nicht.

Kritische Staats- und Regierungschefs
Die EVP des Konservativen Juncker war damals stärkste Kraft geworden, Grossbritanniens Premier David Cameron wollte den Luxemburger nach der Europawahl aber zunächst noch mit allen Mitteln verhindern. Der Brite drohte dabei sogar mit dem EU-Austritt.
Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zögerte mehrere Tage, bevor sie Juncker unterstützte - und gilt bis heute nicht als begeisterte Unterstützerin des Spitzenkandidaten-Prozesses.
Skeptisch ist auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron: Seine für die Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr gegründete Bewegung La République en Marche ist zu klein, um im EU-Parlament alleine Gewicht zu haben.
Auch wenn es Gespräche mit den Liberalen gibt, hat die Suche nach Verbündeten unter Europas Parteien bisher nicht zu Allianzen geführt. Macron muss deshalb fürchten, dass er in der Frage des künftigen Kommissionschefs nicht mitreden kann.
«Kein Automatismus»
Die EU-Staats- und Regierungschefs stellten bei ihrem Gipfel im Februar nochmals klar, dass es auch 2019 «keinen Automatismus» in der Frage der Ernennung des Kommissionschefs geben werde. Sie lesen den EU-Vertrag so, dass sie das alleinige Vorschlagsrecht haben. Ist ihr Kandidat aber kein «Spitzenkandidat», müssen sie fürchten, dass er im EU-Parlament keine Mehrheit bekommt und durchfällt.
Die notwendige mehrheitliche Zustimmung der EU-Abgeordneten bedeutet auch, dass nicht unbedingt der Spitzenkandidat der stärksten Parteienfamilie auf den Posten des Kommissionschefs gesetzt ist. Denn keine Fraktion wird nach den Wahlen über 50 Prozent der Abgeordneten stellen. Bündnisse gegen den Spitzenkandidaten des Wahlsiegers haben also durchaus Chancen, den Kommissionschef zu stellen.