Harvard droht Schlimmes, wenn Donald Trump vor Gericht gewinnt
Die Harvard Universität hat eine Klage gegen die Regierung von Donald Trump eingereicht. Sollte sie nicht Recht erhalten, drohen weitreichende Konsequenzen.
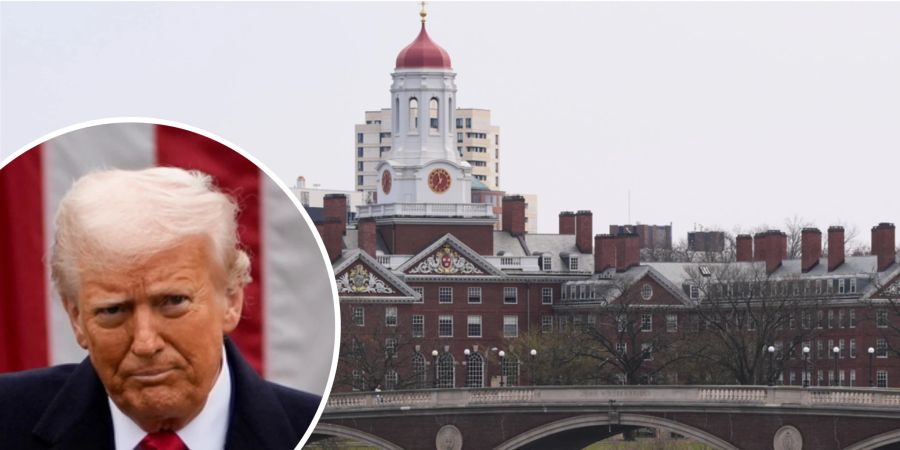
Das Wichtigste in Kürze
- Donald Trumps Regierung versucht, mehr Kontrolle über die US-Universitäten auszuüben.
- Die Harvard Universität wehrt sich gegen die Beschneidung ihrer Freiheit.
- Es kam zur Klage der Elite-Uni gegen die US-Regierung.
- Der Ausgang des Gerichtsverfahrens wird wohl tiefgreifende Folgen haben.
US-Präsident Donald Trump legt sich zurzeit nicht nur mit anderen Ländern an: Auch die landeseigenen Universitäten werden ordentlich unter Druck gesetzt.
In einem Schreiben fordert der Republikaner einen Kurswechsel – unter anderem in Bezug auf die Auswahl von Studenten und Lehrpersonal.
Insbesondere die Elite-Uni Harvard wehrt sich vehement gegen die neuen Richtlinien. Die Trump-Regierung wolle «kontrollieren, wen wir anstellen und was wir unterrichten», kritisiert Harvard-Präsident Alan Garber. Das Vorgehen sei ein Verstoss gegen die Meinungsfreiheit.
Harvards Standhaftigkeit hat Folgen: Donald Trump kürzte kurzerhand 2,2 Milliarden US-Dollar Fördergelder für die Universität in Massachusetts.
Auch mit dem Entzug von Steuervorteilen hat der US-Präsident gedroht.
Die Elite-Uni will nun gerichtlich gegen die US-Regierung vorgehen. Sie verklagt unter anderem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., Bildungsministerin Linda McMahon und Verteidigungsminister Pete Hegseth. Donald Trump steht nicht namentlich auf der Liste.
Doch: Verliert Harvard das Verfahren, könnte das katastrophale Konsequenzen nach sich ziehen. Davor warnt jetzt eine USA-Expertin gegenüber Nau.ch.
Harvard setzt sich zur Wehr
Das ultimative Ziel von Harvard steht für USA-Expertin Claudia Brühwiler von der Universität St. Gallen fest: «Sicherlich erhofft sich Harvard, dass die Regierung die Forderungen herunterschraubt und sich konzilianter zeigt.»
Die Universität wolle aber auch ein Zeichen setzen: «Es geht wohl hier weniger um einen möglichen Sieg vor Gericht, als vielmehr um ein klares Signal an die Regierung: Harvard will sich nicht so einfach in die Ecke drängen und in ihrer Freiheit einschränken lassen.»
Die Elite-Uni setze sich also schlicht zur Wehr. Und: «Harvard will auch andere Hochschulen dazu bringen, sich solidarisch zu zeigen und sich ebenfalls zu widersetzen», so Brühwiler.
Die problematische Einmischung von Donald Trump
Für die Politologin ist klar: Die Kontrollausübung der Regierung auf Universitäten ist «absolut problematisch». Brühwiler: «Die Regierung ist wort- und rechtsbrüchig geworden, indem sie ihre eigenen Abmachungen nicht einhält.»
Ausserdem habe die Taskforce von Donald Trump Forderungen an die Universitäten gestellt, «die deren Autonomie beschnitten hätten».
Sarah Wagner, ebenfalls Politikwissenschaftlerin mit Fokus auf die USA, stimmt dieser Einschätzung zu: «Die geplanten Eingriffe der Regierung in die Arbeit der Universität sind ein weiteres Anzeichen für den aggressiven und autoritären Politikwechsel, den wir in den USA beobachten können.»
Donald Trump und seine Regierung würden sich derzeit als einziges Machtzentrum ohne Kontrollinstanz sehen. Ausserdem seien die Forderungen ein Beispiel für den stark ideologischen Fokus von Trumps Regierung.
Für Wagner ist das Ziel klar: «Den Sektor der Hochschulbildung zu schwächen und unter Kontrolle zu bringen.»
Vize-Präsident Vance seien die Universitäten schon lange ein Dorn im Auge. «Vance zitiert gerne Präsident Nixon mit den Worten ‹Die Professoren sind der Feind›», so Wagner.
Harvard erhoffe sich nun, der «beispiellosen Ausweitung präsidentieller Macht» durch ein Gerichtsurteil Grenzen zu setzen.
Solidarität in Bildungskreisen
Zumindest zu Teilen scheint Harvard diese Ziele zu erreichen: «Schon jetzt sehen wir, dass sich Vertreter und Vertreterinnen der Universitäten koordinieren, solidarisieren und sich zum Beispiel zahlreich in einem offenen Brief gegen die Handlungen der Regierung und den Beschnitt der universitären Unabhängigkeit aussprechen», so Wagner.
Das dürfte Signalwirkung haben: Die Politikwissenschaftlerin schätzt, dass Harvards Klage und grundsätzliche Haltung weitere Universitäten bestärken dürfte, sich den Forderungen der Regierung zu widersetzen.

Brühwiler merkt jedoch an, dass sich nicht alle Unis die Kosten eines Gerichtsverfahrens leisten können.
Das droht Harvard, wenn sie verlieren
Harvard ist gemäss Brühwiler unter besonderen Beschuss der Trump-Regierung geraten: «Für viele Republikaner steht die Elite-Institution für alles, was ihrer Meinung nach in der Hochschullandschaft schiefläuft.»
Pikant: Sollte Harvard vor Gericht verlieren, wird dies wohl weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen: «Der finanzielle Schaden wäre noch grösser als ‹nur› die ausbleibenden Bundesmittel.»
Ausserdem würde das Verhältnis der Universität zur Bundesregierung nachhaltig zerrüttet werden. Und: «Trumps Taskforce würde sich wohl ermutigt – und berechtigt – fühlen, in den Forderungen noch weiter zu gehen.»
Modell muss überdenkt werden
Brühwiler äussert sich unabhängig des Urteils im Disput mit Donald Trump skeptisch zur Zukunft der Universitäten.
«So oder so müssen US-Universitäten ihr Finanzierungsmodell überdenken.» Dieses werde mittlerweile in politikwissenschaftlichen Kreisen sogar als «Ponzi-System», also Pyramidensystem, bezeichnet.
Damit ist nicht ein illegales Schneeballsystem gemeint. Es beschreibt vielmehr die Art, wie Geldflüsse und Erwartungen organisiert sind.
Teil des Modells ist, dass sich Professoren oft selbst über erfolgreiche Projekte finanzieren müssen. Diese werden nämlich von den Bundesstaaten subventioniert.
«Dieses Modell ist kaum länger tragbar», kritisiert Brühwiler.























